
22,5 Millionen Tonnen gefährliche Abfälle in Deutschland im Jahr 2023
Bau- und Abbruchabfälle machen über ein Drittel aller gefährlichen Abfälle aus
Nach Abfallarten betrachtet machten Bau- und Abbruchabfälle wie schon in den Vorjahren den größten Anteil an der Gesamtmenge gefährlicher Abfälle aus. Im Jahr 2023 betrug ihr Anteil 8,6 Millionen Tonnen oder 38,4 % des Gesamtaufkommens. Die zweitgrößte Menge stammte aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie aus der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und für industrielle Zwecke (darunter Kläranlagen und Wasserwerke) mit zusammen 7,0 Millionen Tonnen oder 31,0 %. Im Jahr 2022 hatten die Anteile beider Abfallarten 40,2 % (9,3 Millionen Tonnen) beziehungsweise 29,3 % (6,8 Millionen Tonnen) der Gesamtmenge gefährlicher Abfälle betragen.
Mehr als 60 % der gefährlichen Abfälle aus zwei Wirtschaftsabschnitten
Der Großteil der gefährlichen Abfälle wurde im Jahr 2023, wie in den Vorjahren, in zwei Wirtschaftsabschnitten erzeugt: 9,1 Millionen Tonnen oder 40,3 % der Abfälle stammten aus dem Abschnitt „Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen“ (2022: 9,4 Millionen Tonnen; 40,8 %). Dazu zählen beispielsweise Entsorgungsanlagen wie Deponien oder Anlagen zur Aufbereitung flüssiger und wasserhaltiger Abfälle mit organischen Stoffen, die bei unsachgemäßer Entsorgung über das Abwasser indirekt in Gewässer und damit in die Umwelt gelangen können. 4,9 Millionen Tonnen oder 21,5 % der gefährlichen Abfälle (2022: 4,7 Millionen Tonnen; 20,4 %) stammten aus dem Wirtschaftsabschnitt „Verarbeitendes Gewerbe“, und dort insbesondere aus Betrieben zur Herstellung von Maschinen, Metallerzeugnissen und chemischen Erzeugnissen.
Überwiegender Anteil durch Primärerzeuger
16,1 Millionen Tonnen (71,6 %) der gefährlichen Abfälle stammten im Jahr 2023 von Primärerzeugern, bei denen die Abfälle im eigenen Betrieb erstmalig angefallen sind. Das waren 5,3 % oder 0,9 Millionen Tonnen weniger als im Jahr 2022. 6,4 Millionen Tonnen (28,4 %) waren sogenannte sekundär erzeugte Abfallmengen aus Zwischenlagern oder von Abfallentsorgern, bei denen der Abfall nicht ursprünglich entstanden ist. Die Menge gefährlicher Abfälle sank hier gegenüber 2022 um 5,5 % oder 0,3 Millionen Tonnen.
Weitere Informationen
- Weitere Ergebnisse zur Erhebung der gefährlichen Abfälle für das Jahr 2023 und zurückliegende Jahre stehen in den Tabellen 32151 in der Datenbank GENESIS-Online zur Verfügung.
- Detaillierte Informationen und methodische Erläuterungen sind im Qualitätsbericht enthalten.
| Methodische Hinweise |
| Die Erhebung der gefährlichen Abfälle erfasst alle im Inland erzeugten gefährlichen Abfälle, die der sogenannten Begleitscheinpflicht unterliegen. Dazu zählen beispielsweise Verpackungen mit Verunreinigungen, blei-, nickel- oder cadmiumhaltige Batterien, Leuchtstoffröhren, chlorierte Maschinen-, Getriebe-, Schmieröle. Abfälle aus privaten Haushalten unterliegen nicht der Begleitscheinpflicht und sind daher in den Ergebnissen nicht enthalten. Ebenfalls nicht enthalten sind innerbetrieblich entsorgte Abfälle sowie von und nach Deutschland exportierte und importierte Abfälle, die gesondert erfasst werden. |
Quelle: Pressemitteilung Destatis
Das könnte Sie auch interessieren:
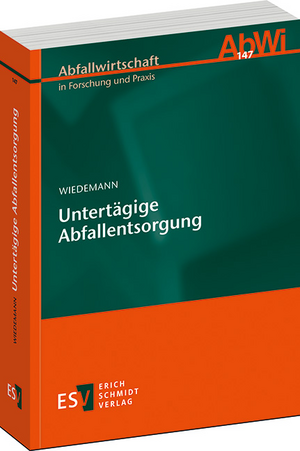 |
Untertägige Abfallentsorgung Autor: Dr. Hartmut Ulf Wiedemann Programmbereich: Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft In aller Tiefe |
| Gefahrstoffe | 26.06.2025 |
| Trifluoressigsäure (TFA): Bewertung für Einstufung in neue Gefahrenklassen vorgelegt | |
 |
Die Bundesstelle für Chemikalien (BfC) an der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ist die zuständige Behörde in Deutschland für die europäische Chemikalienverordnung REACH und die CLP-Verordnung zur Einstufung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe. In Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt (UBA) und dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat die BfC ein entsprechendes Dossier nach der CLP-Verordnung zur Harmonisierung der Gefahreneinstufung von Trifluoressigsäure (TFA) bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) eingereicht. mehr … |
Programmbereich: Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft
