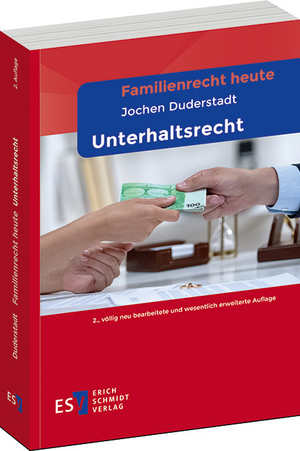Die Mutter des Antragsgegners lebt in einer vollstationären Pflegeeinrichtung (Foto: Peter Atkins / stock.adobe.com – Symbolbild)
Selbstbehalt bei Unterhaltsrückgriff durch Sozialhilfeträger
BGH äußert sich zum angemessenen Selbstbehalt beim Elternunterhalt
ESV-Redaktion Recht
06.12.2024
Der BGH hat sich in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss mit dem Mindestselbstbehalt befasst, der unterhaltspflichtigen Kindern bleibt, wenn diese vom Sozialhilfeträger für ihre pflegebedürftigen Eltern im Wege des Unterhaltsrückgriffs herangezogen werden.
Antragsteller in dem Streitfall ist ein Sozialhilfeträger. Er nimmt den Antragsgegner für die Zeit von Juli bis Dezember 2020 auf Elternunterhalt für dessen pflegebedürftige Mutter in Anspruch.
Die Mutter lebt in einer vollstationären Pflegeeinrichtung. Sie kann die Kosten für ihre Heimunterbringung mit ihrer Sozialversicherungsrente und den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nicht vollständig aufbringen.
Daher erbrachte der Antragsteller für den benannten Zeitraum Sozialhilfeleistungen von monatlich etwa 1.500 EUR.
Der Antragsgegner ist verheiratet. Sein Jahreseinkommen betrug im Jahr 2020 etwa 133.000 EUR brutto. Zusammen mit seiner nicht erwerbstätigen Ehefrau und zwei volljährigen Kindern bewohnte er ein Einfamilienhaus, das den Ehegatten gehörte.
Nachdem das AG Rheinberg den Zahlungsantrag des Sozialhilfeträgers von 7.126 EUR mit Beschluss vom 04.04.2023 (9a F 76/22) zurückgewiesen hat, blieb auch dessen Beschwerde vor dem OLG Düsseldorf ohne Erfolg (siehe Beschluss vom 04.12. 2023 – 3 UF 78/23 ). Das OLG hatte das Bruttoeinkommen des Antragsgegners um
- Steuern und Sozialabgaben,
- Unterhaltspflichten für eines der volljährigen Kinder
- berufsbedingte Aufwendungen,
- sowie um Altersvorsorgeaufwendungen
bereinigt.
Dabei kam es auf unterhaltsrelevante Nettoeinkünfte des Antragsgegners zwischen 5.451 EUR und 6.205 EUR im Monat. Nach weiterer Auffassung des OLG richtet sich der Mindestselbstbehalt beim Elternunterhalt aufgrund von 94 Abs. 1a Satz 1 und 2 SGB XII (siehe unten) – eingeführt durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz – nach dem Nettobetrag.
Dieser lasse sich überschlägig aus einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 € nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben errechnen, so das OLG weiter. Damit hielt es einen Familienmindestselbstbehalt von 9.000 € bei Verheirateten für angemessen. Gegen die Entscheidung des OLG Düsseldorf wendete sich der Sozialhilfeträger mit einer Rechtsbeschwerde an den BGH.
| Der kostenlose Newsletter Recht – Hier können Sie sich anmelden! |
Redaktionelle Meldungen zu neuen Entscheidungen und Rechtsentwicklungen, Interviews und Literaturtipps.
|
BGH: Ansatz der Vorinstanz systemfremd
Der XII. Zivilsenat des BGH hat die Entscheidung des OLG Düsseldorf aufgehoben und die Sache dorthin zurückverwiesen. Die wesentlichen Erwägungen des Senats:
- Orientierung am Nettoeinkommen systemfremd: Der Senat hält die Orientierung des OLG für den Mindestselbstbehalt am Nettoeinkommen für systemfremd.
- Faktisch erhöhte Jahreseinkommensgrenzen nicht beabsichtigt: Demnach wollte der Gesetzgeber durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz, mit dem er die Einkommensgrenze in das SGB XII einführte, die zivilrechtlichen Unterhaltspflichten von Kindern gegenüber ihren Eltern nicht ändern. Die Vorwegbereinigung des Nettoeinkommens durch die Vorinstanz führt nach Auffassung des Senats aber faktisch zu deutlich höheren Jahreseinkommensgrenzen. Diese Erhöhung habe der Gesetzgeber aber nicht gewollt.
Für das weitere Verfahren
Zur Orientierung der Vorinstanz für das weitere Verfahren ließ der Senat die Mindestselbsthalte nach den Leitlinien der Oberlandesgerichte – wie etwa 2.650 EUR für 2024 – rechtlich unbeanstandet.
Der Senat sieht es grundsätzlich auch nicht als rechtsfehlerhaft an, dem Unterhaltspflichtigen mehr als die Hälfte des Einkommens das den Mindestselbstbehalt übersteigt, zusätzlich zu belassen.
Abschließend führt der Senat aus, dass die Zurückverweisung der Vorinstanz die Gelegenheit gibt, sich mit den Einwendungen des Sozialhilfeträgers gegen die Anerkennung der monatlichen Einzahlungen auf Sparbücher als sekundäre Altersvorsorge zu befassen.
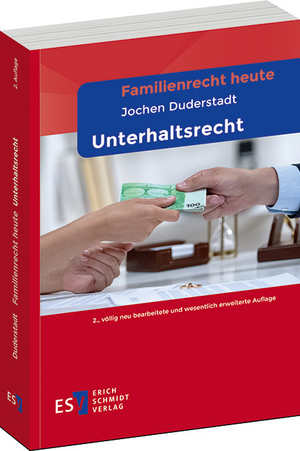 |
Autor: Jochen Duderstadt
Eine ausführliche Darstellung des gesamten materiellen Unterhaltsrechts, angereichert mit zahlreichen Beispielen aus der neuesten Rechtsprechung und vielen pointierten, kritischen Stellungnahmen. In der 2. Auflage rundum aktualisiert, beleuchtet Jochen Duderstadt alle dabei relevanten materiellrechtlichen und die wichtigsten prozessualen Probleme, die sich um einen Unterhaltsstreit ranken können. Schwerpunkte und besondere Einzelaspekte sind:
- Einkommenslehre einschließlich Schuldenberücksichtigung
- Einschlägige unterhaltsrechtliche Konstellationen: Minderjährige und volljährige Kinder gegen ihre Eltern, Eltern gegen Kinder, Kinder gegen Großeltern, unverheiratete Mütter gegen Väter, geschiedene Ehepartner gegeneinander (mit Verwirkungsproblematik)
- Aktuelle Berechnungsbeispiele: Aauch zum besseren Verständnis besonders schwieriger Konstellationen wie z.B. der Anteilshaftung beim Volljährigenunterhalt, beim Elternunterhalt und beim Wechselmodell
- Steuerliche und vollstreckungsrechtliche Fragen
Vollständigkeit, fachübergreifende Ansätze und last but not least der unterhaltsame Stil machen das Buch zu einer leicht zugänglichen Arbeitshilfe – für Juristen wie Nichtjuristen!
Weitere Bände des Gesamtwerks widmen sich den Scheidungsfolgesachen Vermögensrecht und Kindschaftsrecht sowie grundlegend dem Thema Scheidung und Scheidungsfolgen.
Hören Sie hier den Podcast: ESV im Dialog: Neue Entwicklungen und Tendenzen im Familienrecht – Bernd Preiß im Gespräch mit Jochen Duderstadt.
Das Familienrecht ist ständig in Bewegung. Sei es durch Änderungen der Rechtsprechung oder durch den Gesetzgeber. Auch die Lebensgewohnheiten wandeln sich. All dies hat Auswirkungen auf das Scheidungs- und Unterhaltsrecht, das Vermögensrecht oder das Kindschaftsrecht. Stichworte wären hier etwa das umstrittene und komplizierte Unterhaltrecht beim Wechselmodell oder der Systemwechsel beim Ehegattenunterhalt.
Hierüber und über viele weitere aktuelle Fragen hat sich die ESV-Redaktion mit Rechtsanwalt Jochen Duderstadt unterhalten. Jochen Duderstadt ist Fachanwalt für Familienrecht in Göttingen.
|
| Auch interessant |
22.11.2024 |
| BSG: Zweistufige Auskunftspflicht von Kindern gegenüber Sozialamt bei Unterhaltsrückgriff |
 |
Seit 2020 gehen Unterhaltsansprüche der Eltern gegen ihre erwachsenen Kinder auf die Sozialhilfeträger über, wenn das Jahreseinkommen des jeweiligen Kindes 100.000 EUR brutto übersteigt. Die Kinder müssen dann sowohl mit Ihrem Einkommen als auch mit ihrem Vemögen einstehen. Zugunsten der Kinder vermutet das Gesetz, dass die Einkommensschwelle grundsätzlich nicht überschritten wird. Widerlegt der Sozialhilfeträger diese Vermutung, kann er Auskunft vom unterhaltsverpflichteten Kind verlangen. Ob sich dieser Auskunftsanspruch aber zunächst nur auf das Einkommen beschränkt oder sich auch schon auf das Vermögen erstreckt, ist umstritten. Nun hat das BSG diese Frage entschieden. mehr …
|
| Im Wortlaut: § 94 1a SGB XII |
(1a) 1Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern sind nicht zu berücksichtigen, es sei denn, deren jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 des Vierten Buches beträgt jeweils mehr als 100?000 Euro (Jahreseinkommensgrenze). 2Der Übergang von Ansprüchen der Leistungsberechtigten ist ausgeschlossen, sofern Unterhaltsansprüche nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen sind. (…)
|
(ESV/bp)
Programmbereich: Bürgerliches Recht, Zivilverfahrensrecht