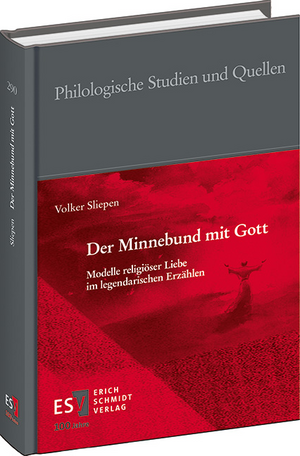Das Wunder als Zeichen im legendarischen Erzählen
„Der Fokus der Forschung hat sich früh auf das legendarische Wunder gerichtet. Dies ist naheliegend, da das Wunder die unmittelbarste Veranschaulichung des transzendenten Wirkens in der Immanenz der Erzählwelt darstellt. So kommt Günther Müller [in seiner Studie zur Form der Legende] bereits 1930 zu dem Urteil, dass die Legende auf den Höhe- und Wendepunkt des Wunders zulaufe. Auch Hellmut Rosenfeld betont ab den 1940er Jahren die zentrale Bedeutung des Wunders, auch wenn es Legenden ohne Wundererzählung gebe. Die quellen-, motiv- und stoffgeschichtlichen Ansätze versuchen, Legenden zu definieren und zu klassifizieren. Müller grenzt die Legende von der Novelle ab, Rosenfeld nähert sie der Heldensage an, Max Lüthi übernimmt die Nähe zur Sage und grenzt Legenden wiederum vom Märchen ab. In der Auseinandersetzung mit Rosenfeld konstatiert er: „Das Übernatürliche, das Wunder ist eben doch das Signum des Heiligen, es gehört wesensmäßig zu Sage und Legende, dort als unbewältigtes oder nur teilweise bewältigtes und eingeordnetes Numinoses, hier als Heiliges, von Gott bewirkt und ihn bezeugend[]“ [Lüthi, Märchen, 2004]. Während Lüthi mit Rudolf Otto religionswissenschaftlich argumentiert, kommt [Ulrich] Wyss in den 1970er und 1980er Jahren auf der Basis von Hegels Literaturbegriff zu dem Urteil, dass sich das Wunderwirken der Heiligen einem rationalen Nachvollzug entziehe und sich die Legende durch eine „schreckliche Inkommensurabilität des Erzählten“ auszeichne: dem „spezifische[n] Skandalon aller Legendenerzählungen“. Mit [Edith] Feistners 1995 erschienenem „Grundlagenwerk“ rückt dann erstmals ein historisch variables Verständnis der Gattung in den Blick:
„Das Wunder als von Gott bestätigtes und den Menschen offenbartes Zeichen der Heiligkeit ist somit ein konstitutives Element der Legende – Ausnahmen bestätigen lediglich die Regel – , auch wenn sich der Wunderbegriff als solcher historisch wandeln und nicht mehr nur auf die spektakuläre und thaumaturgische Tat, sondern etwa auf das Ausharren und Überleben in äußerster Askese angewendet werden konnte.“
Feistner sieht im Wunder ein wichtiges Strukturelement der Legende und wendet sich nicht zuletzt gegen die formale Festschreibung der Texte als „einfache[], naive[] unreflektierte[] Berichte[].“ Gegen Rosenfelds enges Gattungsverständnis im Allgemeinen und den Ausschluss von Mirakelerzählungen im Speziellen wendet sich Elke Koch in dem 2019 erschienenen Buchprojekt Legendarisches Erzählen:
„Auch wenn inhaltliche und funktionale Differenzen geltend gemacht werden können, um Heiligenleben oder -passionen von Mirakelerzählungen zu unterscheiden, erscheint es mit Blick auf den gemeinsamen Rahmen des Glaubens an Heilsmittlerschaft gezwungen, in vitae und post mortem gewirkte Wunder zu separieren. Kaum eine Legendenerzählung verzichtet auf Wunder, die zeigen, wie der Heilsmittler im ‚irdischen Leben‘ schon Heilsfunktionen qua seiner virtus ausüben darf.“
Falls Sie mehr über die Motivdichte in mittelalterlichen Heiligenlegenden erfahren möchten, finden Sie die Antworten der Autorinnen hier:
| Nachgefragt: JProf. Dr. Julia Weitbrecht und Prof. Dr. Elke Koch | 23.08.2019 |
| Weitbrecht/Koch: „Das Interesse an Heiligkeit ist eine Epochensignatur des Mittelalters“ | |
 |
Legenden erzählen von dem Leben heiliger Personen – so viel ist über diese Textsorte bekannt. Damit verbunden ist die Vorstellung von eher schematischen Texten. Doch tatsächlich sind Legenden reich an Motiven und Formen. Vielleicht kommen in Bezug auf Legenden noch Stichwörter wie Märtyrer- oder Bekennerlegende in den Kopf, auch Jungfräulichkeit und Askese. Vom Aufbau her scheinen Legenden sehr ähnlich. mehr … |
Um „die Bedeutung des Erzählens von Wundern insgesamt zu würdigen“, möchte ich im Folgenden auch die Opferbereitschaft des Heiligen mit dem Wunder zusammendenken. Dass legendarische Texte immer wieder das Opfer thematisieren, ist keine neue Entdeckung. Allerdings blieb bisher weitgehend unbeachtet, dass menschliches Opfer und göttliches Wunder in vielen Fällen eine strukturelle Einheit bilden. Während die heidnischen Christenverfolger das kultische Opfer der Götzenverehrung zelebrieren und den Heiligen ihren Göttern als Menschenopfer darbringen wollen, sind die Opfer des Heiligen dem christlichen Ritus nachempfunden, und bisweilen scheint es, als würden sich die Protagonisten selbst als Opfer darbringen. Legenden erzählen also von bösen und guten Opfern und dem Umschlagen von bösartiger in gutartige Gewalt.“
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik