
„Digitale Medien sind sehr wichtig“
Katrin Biebighäuser/Diana Feick: Digitale Medien sind nach wie vor sehr wichtig im DaF/Z-Unterricht. Digitale (mobile) Endgeräte ermöglichen Zugang zu Ressourcen und Informationen, sie unterstützen Lehr- und Lernprozesse bzw. ermöglichen diese erst (z. B. in hybriden oder Online-Unterricht) oder können sie individualisieren, sind also multifunktional und im Alltag vieler Lernenden omnipräsent. Besonders hervorzuheben ist ihre Relevanz als Kommunikationswerkzeug: DaF/Z-Lernende müssen zunehmend auch darauf vorbereitet werden, auf Deutsch kompetent in digitalen Anwendungen oder sozialen Medien zu interagieren um damit auch an der deutschsprachigen Gesellschaft teilhaben zu können. Nicht zuletzt stellen digitale Medien auch den Zugang zu KI-Tools bereit, die immer bedeutsamer im DaF/Z-Unterricht werden.
Was können maschinelle Übersetzungsprogramme leisten?
Katrin Biebighäuser/Diana Feick: Diese Werkzeuge sind in der letzten Dekade sehr leistungsstark geworden und für viele Lernenden mittlerweile eine wichtige Ressource beim Sprachenlernen. Aktuelle Studien, wie die von Antonie Alm in unserem Buch, zeigen, dass sie nicht nur für das bloße Übersetzen, sondern auch beim Lesen, Schreiben oder Kommunizieren auf Satz- und Textebene zum Einsatz kommen. Daher gilt es, ihren Wert als Lernhilfe zu erkennen und zu nutzen, Nutzungsstrategien einzuüben und zur Reflexion ihrer Limitationen anzuregen, aber auch zu vermitteln, dass Bedeutungserschließung weiterhin auch durch andere nicht-digitale Lern- oder Kommunikationsstrategien erfolgen kann.
Wie sieht es mit Chatbots aus? Und mit ChatGPT?
Katrin Biebighäuser/Diana Feick: Auch Chatbots sind mittlerweile ihren Kinderschuhen entwachsen und können eine quasi-authentische Kommunikation simulieren. Lernende können somit sprechend oder schreibend in einem geschützten Raum ein Gespräch auf ihrer Niveaustufe führen und sich gleichzeitig auch noch (korrektives) Feedback sowie Lerntipps geben lassen oder eine Grammatikregel erklärt bekommen. Das Lernen kann damit noch individualisierter erfolgen. Maria Petrova zeigt in unserem Band, wie russische Deutschlernende Chabots nutzen, im ihre phonetische Kompetenz zu verbessern. Natürlich ist auch hier das beste Resultat zu erzielen, wenn wir uns (und den Lernenden) die Funktionsweisen und Limitationen bewusstmachen und ethische Aspekte von KI kritisch hinterfragen. Zudem müssen Lernende in der Lage sein, ihren eigenen Lernprozess auf einer Metaebene zu beurteilen, um selbst entsprechende Erklärungen oder Korrekturen zu erbitten und auf ihre eigene Sprachproduktion anwenden zu können.
Die Erkenntnisse zu Chatbots lassen sich auch auf KIs wie ChatGPT übertragen. Aber auch wenn diese aufgrund der Nutzung immenser Daten sehr schnell immer genauer werden, ist ChatGPT letztlich nur ein „stochastischer Papagei“, kann also falsche Informationen erfinden (halluzinieren), nicht kreativ neues Wissen erzeugen oder das empathisch-emotionale Gespräch mit einer echten Person ersetzen. Zudem ist die Frage der Klimafreundlichkeit auch bei diesen Technologien immer mitzubedenken.
| Auszug aus: „Digitale Lehr-/Lernressourcen und digitale Kompetenz. Forschung aus dem Hochschulkontext“ | 26.03.2025 |
| Digitaler Wandel im DaF/DaZ-Unterricht | |
 |
In einer Welt, die von ständigem Wandel und digitalen Innovationen geprägt ist, verändert sich auch der Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (DaFZ) rasant. Die Corona-Pandemie hat diesen Wandel beschleunigt und Lehrende sowie Lernende vor Herausforderungen gestellt, zugleich aber auch neue Chancen eröffnet: Digitale Tools bieten unzählige Möglichkeiten, den Sprachunterricht flexibler, interaktiver und individueller zu gestalten. Nun gilt es, die Nutzung der neuen Ressourcen und den Erwerb der dazugehörigen Kompetenzen zu erforschen. mehr … |
Kann man auch digitale Spiele in den Unterricht mit einbauen?
Katrin Biebighäuser/Diana Feick: Ja, vor allem mit jüngeren bzw. jugendlichen Lernenden, die gern auch spielerisch lernen, bietet das digitale spielbasierte Sprachenlernen große Potenziale. Letztlich besteht in der grundsätzlichen Anwendbarkeit kein Unterschied zu analogen Spielen. Ein kurzes Wortschatzquiz, das gern auch zwischen verschiedenen Teams ausgetragen wird, fördert nicht nur die Motivation, sondern nutzt digitale Spiele gezielt zur Wiederholung und Automatisierung von sprachlichen Elementen. Diese sogenannte Gamifizierungselemente lassen sich gut in jeden Unterricht integrieren. Der Vorteil digitaler Spiele ist, dass diese schnell selbst oder von anderen Nutzenden (oder einer KI) erstellt werden können; bei Letzteren sollte die Lehrperson natürlich überprüfen, inwieweit die fremderstellten Spiele sprachlich korrekt und der Lernendengruppe gegenüber angemessen sind. Serious Games, also Spiele, in denen Lernende in eine digitale Welt eintauchen und Abenteuer erleben oder Aufgaben lösen, ermöglichen zudem nicht nur sprachliches, sondern auch kulturelles Lernen und könnten z. B. im Projektunterricht sinnvoll traditionelle(re) Materialien ergänzen.
Sie haben ein Symposion zum Thema veranstaltet. Was waren die Ergebnisse?
Katrin Biebighäuser/Diana Feick: Wir haben erkannt, dass die Erforschung des Themas der digitalen Lehr- und Lernressourcen für Grammatik, Phonetik oder Wortschatz, zu denen auch digitale Spiele zählen, gerade besonders von Interesse in der Forschungscommunity sind. Dabei werden Forschende z. T. auch selbst zu Entwickler:innen und überprüfen theoriegeleitet empirisch mit den unterschiedlichsten Verfahren die Funktionen, den Nutzen und Einsatzszenarien der erstellten Ressourcen für das Sprachenlernen. Das ist ein wünschenswerter Ansatz, der leider in kommerziellen Settings oft viel zu kurz kommt. Als zweiter relevanter Forschungsbereich stellte sich das Thema der digitalen Kompetenz generell und im Besonderen in vielfältigen sozio-kulturellen Lehr-/Lernkontexten heraus: Welche Kenntnisse und Einstellungen benötigen Lernende in Bezug auf digitale Lernressourcen? Und wie kann auch in ressourcenärmeren Regionen der Welt dieses (Sprach-)Bildungsziel verfolgt werden? Da das Symposium noch vor der Einführung von ChatGPT stattfand, ist offensichtlich, dass der Diskurs um digitale Kompetenz für das Sprachenlernen und -lehren nun auch um die Förderung von KI-Kompetenz bei Lehrenden und Lerrnenden erweitert werden muss.
Was ihr ihr ganz persönlicher Tipp zu gutem Sprachenlernen im digitalen Kontext?
Katrin Biebighäuser/Diana Feick: Unser Tipp ist, sich auch als digitale:r Amateur:in nicht vor neuen Technologien zu verschließen, sondern neugierig zu bleiben, auszuprobieren und mit den Lernenden gemeinsam die Vor- und Nachteile digitaler Tools zu erkunden.
Vielen Dank für das Interview!
| Die Herausgeberinnen |
| Dr. Diana Feick ist Juniorprofessorin (Tenure Track) für DaF/Z mit Schwerpunkt auf empirischer Unterrichtsforschung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zuvor war sie Senior Lecturer an der University of Auckland in den Bereichen German und Applied Linguistics/Language Teaching. Zusammen mit Dr. Katrin Biebighäuser hat sie zum 2. Mal das „Mediendidaktische Symposium DaFZ“ ausgerichtet. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf vielfältigen Aspekten des Lehrens und Lernens mit digitalen Ressourcen in DaFZ. Dr. Katrin Biebighäuser leitet aktuell zwei bilinguale Grundschulen in Heidelberg, an welchen sie die theoretischen und empirischen Erkenntnisse, welche sie aus ihrer Promotion sowie Juniorprofessur im Bereich Deutsch als Fremdsprache mit dem Fokus auf Digitale Medien gewonnen hat, in der Praxis einsetzt und täglich neue spannende Einblicke in Lernkontexte unter Sprachlernbedingungen gewinnt. |
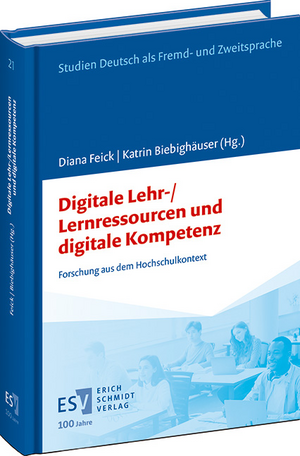 |
Digitale Lehr-/Lernressourcen und digitale Kompetenz Herausgegeben von: Diana Feick, Katrin Biebighäuser Die forschungsbasierte Entwicklung digitaler Lehr-/Lernressourcen in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache ist im Zeitalter der Digitalisierung zunehmend gelebte Hochschulpraxis. Damit einher geht die Erforschung der Nutzung dieser Ressourcen sowie der dazu benötigten digitalen (Teil-)Kompetenzen.
|
Programmbereich: Deutsch als Fremdsprache
