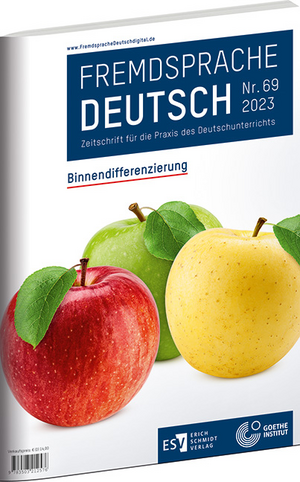„Eine der Strategien, die man zur Binnendifferenzierung erfolgreich anwenden kann, ist die Stille“
Das neueste Heft der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch mit dem Titel „Binnendifferenzierung“, herausgegeben von Katharina Buck und Jana Henscher, zeigt in ausgewählten praxisbezogenen Beiträgen die Potentiale und Grenzen der Binnendifferenzierung; anhand konkreter Unterrichtsbeispiele werden erfolgreiche Herangehensweisen an die Implementierung der Binnendifferenzierung in den Unterricht dargestellt.
Lesen Sie im Folgenden einen Auszug aus dem aktuellen Heft: Ramona Vaļģe zeigt in ihrem Beitrag „Binnendifferenzierung lernen und anwenden – miteinander und voneinander“, wie genau die Methode der Binnendifferenzierung funktionieren kann und gibt ganz konkrete Hinweise für die Unterrichtsgestaltung. Viel Spaß bei der Lektüre.
-------------------------------------------------------------------------------
Binnendifferenzierung lernen und anwenden – miteinander und voneinander (Ramona Vaļģe)
Die Diskussion darum, was gute Schulbildung ist und in welchem Maße alle Beteiligten – Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern – sie beeinflussen können, gibt es schon sehr lange. Was sich allerdings ändert, ist das Verständnis davon, was einen guten, effektiven Lehr- und Lernprozess ausmacht. Heute ist diese Frage aktuell, weil sich u. a. durch die Beschleunigung des Lebenstempos, die Digitalisierung, die höhere Mobilität sowie das sich verändernde Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler die Bedingungen guter Bildung laufend ändern. Lerngruppen und die Voraussetzungen, die Teilnehmende für den Bildungsprozess mitbringen, werden mit diesen Veränderungen heterogener statt homogener. Um mit dieser Unterschiedlichkeit bewusst und gar proaktiv umzugehen, nimmt Binnendifferenzierung heutzutage einen festen Platz in der Schulbildung ein. Allerdings stellen sich Lehrerinnen und Lehrer oft die Frage, was Binnendifferenzierung eigentlich ist, ob sie sie richtig verstehen, auslegen und sinnvoll anwenden. Ich möchte Ihnen hier vorstellen, wie Binnendifferenzierung aus der Perspektive der Wissenschaft, dem Kontext meiner eigenen Schule in Lettland und praktischen, von uns selbst erprobten, Beispielen aussehen kann.
Was ist eigentlich Binnendifferenzierung: Was sagen die Koryphäen?
[...]
Binnendifferenzierung ist eine praktische Umsetzung des Prinzips, mit der Unterschiedlichkeit von Bildungsteilnehmenden bewusst umzugehen.
Eine grundlegende Definition sagt: Binnendifferenzierung eint alle Differenzierungsformen innerhalb einer gemeinsam unterrichteten Gruppe von Lernenden: also vielfältige Methoden, um mit den Unterschieden der Lernenden umzugehen, ohne die gesamte Gruppe dauerhaft aufzuteilen (Klafki/Stöcker, 1991). Dabei arbeiten alle Teilnehmenden an einem gemeinsamen Lernthema. Binnendifferenzierung ist eine Möglichkeit, mit der Heterogenität Lernender aktiv oder gar proaktiv umzugehen. So gehört es für Helmke (2009, 246) zu den Kennzeichen modernen Unterrichts, dass dieser durch »vielfältige organisatorische und didaktische Maßnahmen der Differenzierung und Individualisierung der Heterogenität der Schüler« gerecht wird. Ziel solcher Maßnahmen ist es, möglichst vielen Schülerinnen und Schülern in einer Klasse optimale Lernbedingungen zu bieten, indem ihren unterschiedlichen Lern- und Leistungsvoraussetzungen Rechnung getragen wird: »Das Hauptziel der Anwendung von Binnendifferenzierung ist die Förderung des Lernpotenzials von jeder einzelnen Schülerin und jedem einzelnen Schüler« (Tomlinson 2005, 263).
[...]
Wir sehen also, dass bei allen oben genannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern folgender Punkt gemeinsam ist: Wir, die Lehrkräfte, sollen die Unterschiede der Schülerinnen und Schüler beachten und proaktiv einbeziehen, um den Lernprozess erfolgreich zu gestalten. Darauf, wie wir uns dieser Herausforderung im Kontext meiner eigenen Schule in Lettland nähern, möchte ich im Folgenden eingehen.
[...]
| Das könnte Sie auch interessiereen: Interview mit den Heftherausgeberinnen Katharina Buck und Jana Hensch | 26.10.2023 |
| „Geglückte Binnendifferenzierung wird immer wichtiger“ | |
 |
Wie können wir im Klassenraum unterschiedlichen Interessen, Begabungen, Lerngeschwindigkeiten und kulturellen Hintergründen gerecht werden? Dieser und weiteren Fragen wie „Was ist eigentlich Binnendifferenzierung?“ und „Wo fange ich am besten an?“ gehen Katharina Buck und Jana Hensch in dem von ihnen herausgegeben neuen Heft „Binnendifferenzierung“ der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch nach. mehr … |
Best Practice: Stille als Mittel zur Binnendifferenzierung
Eine der Strategien, die man zur Binnendifferenzierung erfolgreich anwenden kann, ist die Stille. Die Stille als Mittel wird oft unterschätzt und zu wenig genutzt, da Lehrerinnen und Lehrer oft der aktiven Kommunikation im Unterricht nachjagen, denn diese Aktivität wird oft in den Mittelpunkt des modernen Unterrichts gestellt. Jedoch muss alles seinen Sinn haben, sowohl Aktivität als auch Stille. [...] [D]ie Stille [gehört] in den Teil »angepasste Umgebung«. Sie können wir nutzen, ohne den Klassenraum zu verlassen. Welche Vorteile kann die Stille den im Lernprozess einbezogenen Akteurinnen und Akteuren bieten?
- Die Lernenden können sich auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren und spontan die für sie geeignete Lösungsmethode finden.
- Die Lernenden können im eigenen Tempo denken (nicht im Tempo der Lehrkraft oder der Mitschülerinnen und Mitschüler).
- Die Stille bereitet einen fruchtbaren Boden für die Vertiefung eines Unterrichtsthemas.
- Sie gibt Raum für kreatives, intuitives und reflektierendes Denken.
- Sie fördert gleiche Chancen zwischen introvertierten und extrovertierten Teilnehmenden des Unterrichts, und zwar sowohl der Lernenden als auch der Unterrichtenden.
- Sie verleiht dem Unterricht eine gewisse Intimität: Im sicheren Umfeld sind auch schwierigere Aufgaben leichter zu bewältigen.
- Sie fördert selbständiges, bewusstes Lernen, da die Anwesenheit der Lehrkraft im Unterricht sich nur in der stillen Beobachterrolle zeigt.
Notieren von Stichwörtern zum Text oder die Vorbereitung für eine anschließende Gruppendiskussion. Die Stille eignet sich aber auch sehr gut für differenzierende Einzelarbeit, wobei die Schülerinnen und Schüler Aufgaben mit unterschiedlichen Inhalten und differenziertem Schwierigkeitsgrad bearbeiten. Dann kombinieren wir angepasste Umgebung und angepasste Inhalte. Als differenzierenden Schwerpunkt der Stille im
Unterricht möchte ich den respektvollen und zielgerichteten Umgang mit introvertierten Lernenden sowie Lernenden, die eine andere Auffassungsgabe haben als der/die »Durchschnittslernende«, hervorheben.
[...]
Best Practice: Binnendifferenzierung im DaF-Unterricht
Wenn ich den DaF-Unterricht vorbereite und dann inmitten meiner Schülerinnen und Schüler stehe, versuche ich meine Möglichkeiten vor Ort mit den Bedürfnissen und Besonderheiten meiner jeweiligen Klasse zu verbinden, denn unser gemeinsames Ziel ist es, mit möglichst guter Laune, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und uns selbst als Akteurinnen und Akteuren im Prozess zum jeweiligen Lernziel zu kommen. Meine folgenden Beispiele sind gemäß der [...] Aufteilung von Ann Carol Tomlinson [...] geordnet.
Angepasste Umgebung
- In meiner Klasse haben wir die Möglichkeit, die Sitzplätze flexibel umzustellen. D. h., man kann sich gut zusammen, aber auch etwas abseits setzen. Bei der Gruppenarbeit empfinden es die Schülerinnen und Schüler zumeist als angenehm, wenn sie die Tische kompakt zusammenrücken können.
- Für die individuelle Arbeit in der Stille können sich die Schülerinnen und Schüler ihren Sitzplatz aussuchen.
- Für kreative Aufgaben wie Präsentationen, Mini-Projekte u. ä. dürfen die Lernenden vor Beginn der Aufgabe im gemeinsamen Klassengespräch auswählen, wo sie die Aufgabe erledigen: im Klassenraum, in der Schulbibliothek, zu Hause, im Park usw. Meine Bedingung als Lehrkraft ist nur: Die Kriterien für die jeweiligen Aufgaben werden gemeinsam in der Lerngruppe ausgearbeitet und sind für alle bindend.
- Korrekte Umgangsformen in der Lerngruppe sind wichtig. Eine böse Stimmlage ist ein absolutes Tabu sowohl von Seiten der Lehrkraft als auch seitens der Lernenden.
- Man darf und muss immer fragen. Es gibt keine falschen Fragen.
- Für die Vertiefung von Themen lasse ich die begabteren und fleißigeren Lernenden selbst Aufgaben zum Thema entwickeln.
- Die Schnelleren helfen den anderen Mitschülerinnen und -schülern bei der Erledigung der Aufgaben (vorausgesetzt, sie haben sie korrekt erledigt) .
- Es ist oft möglich, Texte zum Thema alternativ auf höherem Niveau zu wählen, damit leistungsstärkere Lernende die Lernmotivation nicht durch Unterforderung verlieren.
- Bei der Vorbereitung zur »Prüfarbeit« bzw. bei der Wiederholung eines Themas bekommen die Lernenden Arbeitsblätter mit Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Sie dürfen die Stufe bzw. die Reihenfolge der Aufgaben wählen. Die Lösungsblätter stehen separat auf einem Tisch oder auf den Fensterbänken. Man darf sie konsultieren, vergleichen, aber nicht zum Sitzplatz mitnehmen. Die Schülerinnen und Schüler werden immer wieder aufgefordert, den Schwierigkeitsgrad der Übungen in Kursbuch/Arbeitsbuch/auf Arbeitsblättern zu wählen: z. B. vorgegebenen Wortschatz verdecken, Dialoge selbst anpassen usw.
- Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen der Aufgaben werden angeboten.
- Die Lernenden dürfen selbst ihre Unterstützung wählen [...].
- Natürlich muss ich den Lernenden immer wieder in Erinnerung bringen, dass die Lehrkraft in der Klasse zwar immer zur Verfügung steht, aber bei Fragen nicht die erste Instanz darstellt [...].
- Viele Aufgaben können die Lernenden entweder individuell oder mit dem/der Sitznachbarn/ Sitznachbarin erledigen. So werden die Introvertierten nicht immer gedrängt, in Paararbeit zu lernen.
- Grammatikspiele können für unterschiedlichen Leistungsstand, Temperamente und, und, und … angepasst werden. [...]
- Introvertierte Lernende, besonders, wenn sie neu in unserer Schule sind, dürfen Fragen an mich auch schriftlich stellen.
- Zum Abschluss eines Themas steht immer eine »Prüfarbeit«. An dieser Stelle lasse ich die Lerngruppe manchmal wählen, was sie machen möchten: eine klassische Klassenarbeit oder ein kreatives Mini-Projekt zum Thema. Die Kriterien zur Form und zum Inhalt der kreativen Arbeit werden immer gemeinsam ausgearbeitet. Bei der Auswertung dieser Produkte werden die Lernenden aktiv einbezogen.
Großen und Kleinen auszuprobieren und umzusetzen. Was aber ist mit unserer Hauptzielgruppe? Was müssen die Lernenden von der Binnendifferenzierung wissen und welche Kompetenzen müssen sie haben, damit unser Experiment gelingt?
[...]
Fazit
Durch den Überblick über die einschlägige Fachliteratur, die Analyse unserer gemeinsamen Weiterbildungen an meiner Schule und vor allem durch die Reflexion der Unterrichtspraxis komme ich zu meinem Fazit, das sich in sechs Stichpunkten zusammenfassen lässt.
- Gemeinsames Lernen des Kollegiums ist sehr hilfreich, doch dieser Aspekt des Unterrichts ließe sich auch allein erfolgreich bewältigen.
- Peer-Hospitationen bei Kolleginnen und Kollegen geben uns Bestätigung, Inspiration und Anregungen für unsere eigene Lehrtätigkeit.
- Binnendifferenzierung ist ein gutes Arbeitsinstrument, das für alle Beteiligten des Lernprozesses fördernd ist.
- Nur das bewusste, proaktive Kennenlernen unserer Lernenden erlaubt es Lehrkräften, Binnendifferenzierung sinnvoll und gewinnbringend einzusetzen und die richtigen Arbeits- und Sozialformen zu wählen.
- Binnendifferenzierung trägt zum bewussten Lernen aller Beteiligten bei, was einen wichtigen Motivationsfaktor darstellt und gute Lernerfolge begünstigt.
Abschließend möchte ich sagen, dass es sich lohnt, sich bewusst mit der Binnendifferenzierung im Unterricht auseinanderzusetzen, denn somit wird allen Beteiligten geholfen. Die Lehrenden arbeiten möglichst gezielt mit der Individualität und Besonderheit jeder und jedes Lernenden und jeder Lerngruppe und werden nicht enttäuscht, dass »schon wieder welche nichts verstanden oder nichts geschafft« haben. Und die Lernenden fühlen sich wahrgenommen und wertgeschätzt und können so erfolgreicher lernen und die gesetzten Lernziele erreichen.
-------------------------------------------------------------------------------
Möchten Sie weiterlesen? Das aktuelle Heft der Zeitschrift „Fremdsprache Deutsch“ können Sie hier oder in jedem Buchhandel erwerben. Alle Hefte der Zeitschrift finden Sie auch online.
| Die Beiträgerin Ramona Vaļģe ist praktizierende DaF-Lehrerin seit 1999, in der Erwachsenenbildung und in der Schulbildung (Musikmittelschule Jelgava, Lettland; Staatsgymnasium Jelgava, Lettland). Seit 2021 ist sie im Vorstand des Deutschlehrerverbandes Lettland. Ihre beruflichen Interessenschwerpunkte sind Schülerprojekte, Weiterentwicklung eigener Unterrichtskompetenzen, Lernmotivatoren. |
Die Heftherausgeberinnen Katharina Buck leitet die Spracharbeit des Goethe-Instituts Ukraine und ist damit verantwortlich für die Bildungsarbeit des Goethe-Instituts im Land mit den fünftmeisten Deutschlerner*innen weltweit. Sie studierte Deutsche Sprache und Literatur, Politikwissenschaft und Internationale Sicherheit und wurde mit einer Arbeit zu Nationalstaatsbildung, Sprachenpolitik und „ethnischen“ Konflikten in Zentralasien und Osteuropa an der University of Bristol promoviert. Berufliche Stationen führten sie bislang neben der Ukraine, Großbritannien und Deutschland unter anderem nach Belgien, Kasachstan, Moldau und Schweden. Jana Hensch ist Expertin für Unterricht am Goethe-Institut Budapest und betreut „PASCH“-Schulen mit vertieftem Deutschunterricht in Ungarn und Zentral-/Osteuropa. Ihr beruflicher Werdegang ist gekennzeichnet durch die stete Verzahnung von eigener Unterrichtspraxis sowie der Lehre bzw. Aus- und Weiterbildung von DaF-Lehrkräften. Bisherige Stationen umfassten u. a. die Philipps-Universität Marburg, die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest sowie die Technische Universität Braunschweig. Sie ist Autorin für die telc gGmbh. |
Programmbereich: Deutsch als Fremdsprache