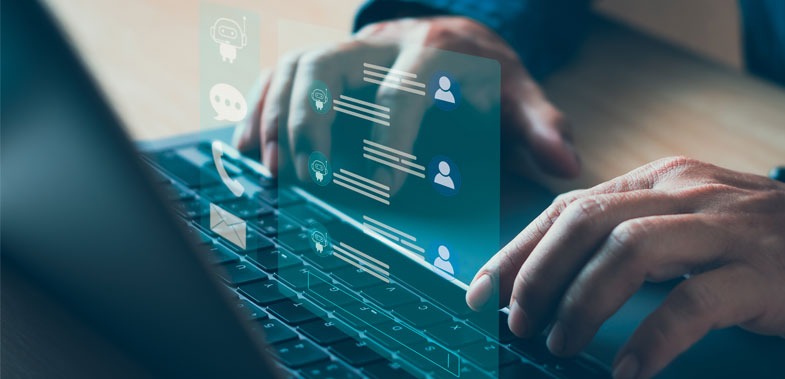
Europäische KI-Verordnung aus Sicht der Lieferketten
Die Regulierungen seien wichtig für die Sicherheit und das Vertrauen in Künstliche Intelligenz. Die Definition von KI müsse präzise sein. Viele Systeme in Lieferketten seien datenbasiert und analytisch, aber keine echte KI. Daher sollten konventionelle IT-Systeme nicht unter die KI-Definition fallen.
Folgendes Beispiel nennt das Unternehmen: Ein System zur Bestandsverwaltung, das Daten sammelt und Berichte erstellt, sollte nicht als KI klassifiziert werden, da es keine maschinellen Lernverfahren oder selbstoptimierende Algorithmen verwendet. Diese Systeme analysieren zwar Daten, generieren aber keine neuen Erkenntnisse oder Optimierungen autonom.
Es sei wichtig, den konkreten Einsatzzweck einer KI-Anwendung und die damit verbundenen Risiken zu berücksichtigen. So solle ein KI-Tool, das Lieferantenbewertungen basierend auf historischen Leistungsdaten erstellt, als weniger riskant eingestuft werden als ein autonomes Fahrzeug zur Warenauslieferung.
Zum Datenschutz: Ein KI-gestütztes System zur Analyse von Lieferkettenrisiken, das personenbezogene Daten verarbeitet, solle bereits den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entsprechen, was unter anderem die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung umfasst.
Der Bankenverband hat zu diesem Thema ein Positionspapier von 14 Verbänden der deutschen Wirtschaft hier veröffentlicht.
 |
ChatGPT in der Unternehmenspraxisvon Wolfhart FabariusDer Einsatz von Künstlicher Intelligenz revolutioniert die Arbeitswelt und mit ChatGPT steht hierbei ein besonders vielseitig nutzbares Anwendungstool zur Verfügung. Wie Sie als Governance-Verantwortlicher den Chatbot sinnvoll einsetzen können, zeigen die Praxisbeispiele in diesem Buch mit thematischen Schwerpunkten wie Nachhaltigkeit, Cybersicherheit, Datenschutz und Überwachung von Lieferketten. |
Programmbereich: Management und Wirtschaft
