
LG Berlin II: Persönlichkeitsrecht kann auch vor Stimmenimitation durch KI schützen
Kläger: Nutzung der KI-Stimme ist rechtswidriger Eingriff allgemeines Persönlichkeitsrecht
Nach dem Vortrag des Klägers wurde die KI-generierte Stimme eindeutig von Zuschauern als dessen Synchronstimme erkannt. Hierin sah der Kläger einen Eingriff in das Recht an seiner eigenen Stimme, die durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht geschützt ist. Deshalb macht er unter anderem Schadensersatz in Form einer fiktiven Lizenzgebühr in Höhe von 2.000 EUR pro Video geltend – also insgesamt 4.000 EUR.
Beklagter: Synthetische Imitation einer Stimme ist keine Originalstimme
Schließlich, so der Beklagte weiter, wären seine Videos satirisch und nicht kommerziell angelegt.
| Der kostenlose Newsletter Recht – Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! |
| Redaktionelle Meldungen zu neuen Entscheidungen und Rechtsentwicklungen, Interviews und Literaturtipps |
LG Berlin II: Allgemeines Persönlichkeitsrecht kann auch vor Nachahmung einer Stimme mithilfe von KI schützen
Das LG Berlin II folgte weitgehend der Auffassung des Klägers. Im Ergebnis verurteilte es den Beklagten zur Zahlung von 4.000 EUR Lizenzschaden sowie von 1.155,80 EUR Rechtsanwaltskosten zuzüglich Zinsen. Den Zinsanspruch sah das LG aber nur in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz als begründet an, weil keine Entgeltforderung nach § 288 Abs. 2 BGB vorliegt. Bei seiner Entscheidung ließ sich das LG im Wesentlichen von folgenden Überlegungen leiten:
- Zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht: Zunächst stellte das LG klar, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch das Recht an der eigenen Stimme schützt. Umfasst hiervon ist dem LG zufolge auch eine Nachahmung einer Stimme mithilfe von KI, wenn diese einen Menschen imitiert.
- Zuordnungsverwirrung: Nach weiterer Ansicht des LG glauben viele Zuschauer, der Kläger selbst habe den Text in den Videos gesprochen. Seine Einschätzung stützt das Gericht vor allem auf die Kommentare unter den Videos: Dort schreiben zahlreiche Nutzer, dass sie die Stimme des Klägers erkannt hätten. Weil der Beklagte die Stimmen absichtlich sehr ähnlich klingen ließ, habe er eine Zuordnungsverwirrung erzeugt – und sogar den Eindruck erweckt, der Kläger habe seine Stimme für die Videos freigegeben.
- Möglicher Reputationsverlust des Klägers: Darüber hinaus könne aufgrund der imitierten Stimme sogar der Eindruck entstehen, der Kläger würde die Inhalte des beklagten YouTubers – den das LG politisch eher rechts einordnet – billigen oder gar fördern wollen. Dies könne dem Ruf des Klägers schaden. Außerdem erkannte das LG keinen Hinweis darauf, dass die Stimme mit KI erzeugt wurde.
- Einsatz für kommerzielle Zwecke: Die Nutzung diente auch kommerziellen Zwecken, weil die Videos mittelbar den Absatz des Online-Shops fördern sollten.
- Keine Einwilligung des Klägers: Eine Einwilligung des Klägers lag nicht vor, denn der Beklagte hatte eine Einwilligung des Klägers nicht vorgetragen.
- Keine Berufung auf Meinungs-oder Kunstfreiheit: Der Beklagte konnte sich auch nicht auf Meinungs- oder Kunstfreiheit berufen. Zwar ist dem LG zufolge ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht nur dann rechtswidrig, wenn das Schutzinteresse des Betroffenen die schutzwürdigen Belange des anderen überwiegt. Allerdings fiel diese Abwägung zugunsten des Klägers aus. Dieser könne sich, so das LG, auch ohne Stimmenimitation mit der Politik der Bundesregierung auseinandersetzen und seine kommerziellen Interessen verfolgen.
- Fiktive Lizenzgebühr: Die fiktive Lizenzgebühr setzte das Gericht auf 2.000 EUR pro Video fest. Maßgebend hierfür waren die hohe Bekanntheit des Klägers als Synchronstimme eines international bekannten Schauspielers sowie die wirtschaftliche Reichweite des YouTube-Kanals.
Quelle: Urteil des LG Berlin II vom 20.08.2025 – 2 O 202/24 (veröffentlicht bei openJur)
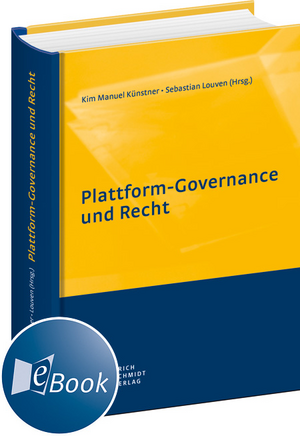 |
|
| Verlagsprogramm |
Weitere Nachrichten aus dem Bereich Recht |
| Urheberrechtliche Schranken | 12.12.2025 |
| OLG Hamburg zur Frage, wann Fotografien ohne Lizenz für KI-Training genutzt werden dürfen | |
 |
Die rasante Entwicklung von KI beruht unter anderem auf massiven Datenmengen, die häufig frei über das Internet zugänglich sind. Dabei gibt es ein großes Spannungsfeld zwischen der Forschung, die große Datenbestände für maschinelles Lernen braucht und den Rechten der Urheber. Die zentrale Frage lautet hier: Wo ist die Grenze zwischen dem wissenschaftlich legitimierten Interesse und der unzulässigen Verwertung geschützter Inhalte? Hierüber hat das OLG Hamburg aktuell entschieden. mehr … |
(ESV/bp)
Programmbereich: Wirtschaftsrecht
