
„Liebe geht durch den Magen“
Sprichwörter tradieren überkommene Wert- und Normvorstellungen, bieten Orientierungshilfen in Form von bewährten Verhaltensratschlägen, warnen vor den Konsequenzen falschen Handelns – kurzum, sie bringen kollektive Lebensweisheiten auf den Punkt und erheben dabei den Anspruch auf Allgemeingültigkeit; man könnte Parömien mit Recht als kulturgeschichtlichen Wertekompass einer Gesellschaft bezeichnen, aber Weltanschauungen sind bekanntlich nicht unwandelbar: Das zeigt sich, wenn man sich auf die Suche nach den Wurzeln des […] heute allgemein bekannten und in vielen Sprachen verbreiteten Sprichworts [„Liebe geht durch den Magen“] macht. Diese vermeintlich zeitlos gültige Universalweisheit ist nämlich weder in den klassischen Spruchsammlungen von Wander und Simrock noch im Thesaurus proverbiorum medii aevi verzeichnet, und auch das „Grimm’sche Wörterbuch“ weiß nichts über ihre Herkunft zu berichten.
Es muss sich also um eine relativ junge Prägung handeln, wobei nicht einmal klar ist, was genau in diesem Zusammenhang mit ‚Liebe‘ gemeint ist. Eine kleine (nicht repräsentative) Umfrage im Freundeskreis hat ergeben, dass mit diesem Sprichwort vielfach an erster Stelle eine ‚Stärkung der Verbundenheit‘ zwischen Ehepartnern assoziiert wird und erst in zweiter Linie die aphrodisierende Wirkung eines gemeinsam genossenen Mahles. Ein Blick ins Internet lässt hingegen den Eindruck entstehen, dass das Sprichwort vorzugsweise in letzterem Zusammenhang bemüht wird. De facto dürften sich beide Aspekte überlagern: Nicht von ungefähr ist das Restaurant der bevorzugte Verabredungsort für das erste Date, also die Anbahnung einer Beziehung, und das harmonische Teilen von Tisch und Bett macht trotz aller gesellschaftlichen Umbrüche immer noch das Charakteristikum einer glücklichen Paarbeziehung aus.
Der Zusammenhang von Essen und Liebe im parömischen Spiegel
Wenn auch das gegenständliche Sprichwort in den einschlägigen Lexika keine besonders ergiebige Trefferquote erbrachte, ist der Blick in den Thesaurus proverbiorum medii aevi dennoch kulturgeschichtlich höchst aufschlussreich: Unter dem Stichwort ‚Liebe‘ ist dort bereits für die Antike eine Reihe von Sprichwörtern und Zitaten verzeichnet, die einen engen Zusammenhang zwischen kulinarischem Genuss und Libido behaupten: ‚Dionysos und Aphrodite gehören zusammen‘, stellten bereits die alten Griechen fest, auch wenn Philosophen und Ärzte zu einem maßvollen Umgang mit gustativen wie sexuellen Begehren mahnten – zu Gunsten körperlicher wie psychischer Gesundheit.
In den späteren Schriften christlicher Autoren des Mittelalters ist diese sinnenfrohe Erkenntnis seit der Etablierung eines Lasterkatalogs durch den asketischen Wüstenmönch Evagrios Ponticos (4. Jh.) und vor allem unter dem Einfluss von Augustinus’ Confessiones praktisch ausnahmslos negativ gewendet worden. Vor kulinarischen Genüssen wird nun ausdrücklich gewarnt, weil sie sexuelle Begierden anstacheln und auf geradem Weg in die Sünde führen würden. Zum Ausdruck kommt diese rigide Einstellung in sprichwortartigen Zitaten wie den folgenden: Pene semper enim epulas comitatur voluptas (‚Denn beinahe immer begleitet Wollust die Mahlzeiten‘), heißt es bei Papst Gregor dem Großen. Venter enim et genitalia proxima sunt; sic ergo gule vicium luxuriam parit (‚Denn der Bauch und die Geschlechtsteile sind sehr nahe beieinander; so erzeugt das Laster der Völlerei die Wollust‘), erklärt Jacobus de Cessolis den fatalen Zusammenhang zwischen gula/gastrimargia und luxuria (mhd. vrâz und unkeusch), die im Hochmittelalter gar zu Todsünden erklärt wurden.
In logischer Konsequenz daraus müsse der Mensch eben alles meiden, was Lust oder gar Wollust (im ursprünglichen Sinn eine wohltuende Empfindung!) evoziere, insbesondere gustatorische Genüsse, die den Geschlechtstrieb stimulieren können. Für Augustinus besteht die Lösung der Wahl darin, genau zu überlegen, was beim Essen und Trinken gesundheitsnotwendig ist und was darüber hinaus nur der Befriedigung von Begierde dient. In der Praxis bedeutet das Selbstdisziplinierung durch Nahrungsverzicht bzw. Fasten, wie es in monastischen Gemeinschaften verpflichtend und auch von der Laienbevölkerung gefordert wurde, denn: Qui male nutritur, hic raro luxuriatur; Luxuriat raro non bene pasta caro (‚Wer schlecht ernährt wird, der treibt selten Unzucht. Das schlecht ernährte Fleisch ist selten wollüstig‘).
Solche und unzählige weitere Äußerungen desselben Tenors bestätigen zum einen, dass auch im Mittelalter ein wechselseitiger Einfluss zwischen den körperlichen Begehrlichkeiten der Nahrungsaufnahme und der geschlechtlichen Lust angenommen wurde. Zum anderen verraten warnende Lebensweisheiten wie Non bene captatur cibus, unde libido paratur (‚Es ist nicht gut, eine Speise zu sich zu nehmen, von der Wollust entsteht‘), dass es offenbar spezielle Nahrungsmittel gibt, denen eine aphrodisierende Wirkung zugeschrieben wurde. Und dass Speisen sogar als Transportmedium für Liebesbeschwörungen dienen konnten, geht aus einem Zitat aus dem Arzneibuch Oswald Gabelkhovers hervor, wo er im Abschnitt über Beschwerden und Krankheitsbilder der Geschlechtsorgane für den Fall, dass man einem die Liebe zu essen hat geben, ein Rezept Fuͤr [= gegen] erzauberte Liebe anführt. Damit ist nämlich vom Autor nichts anderes gemeint, als dass man einem Liebeszauber zum Opfer gefallen ist, also gewissermaßen ‚eingekocht‘ wurde.
[…]
 |
Deutsche Literatur des Mittelalters. Eine Einführung in die Germanistische Mediävistik Von Thomas Bein
|
Das Problem des christlichen Mittelalters mit der Lust
[…] Das ‚verklemmte‘ Verhältnis der christlichen Theologie zum Eros ist […] keine reine Erfindung des Mittelalters, seine Ursprünge liegen viel weiter zurück. Schon für Platon gehörte die aphrodisia als Sammelbegriff für fleischliche Begierden dem niedrigsten, nämlich dem begehrlichen Teil der Seele (epithymia) an, im Gegensatz zum emotionalen (thymos) und zum geistigen Teil der Seele (nous). Triebsublimierung durch Mäßigung galt daher schon in der Antike als jene Fähigkeit, durch die sich der Mensch vom Tier unterscheidet. Eine ähnliche Position vertrat das Judentum, aber zur radikalen Abwertung von Lust als einem Bedürfnis, etwas zu tun oder zu haben, und zugleich als Freude, die man dabei verspürt, kam es erst im Christentum etwa durch Paulus von Tarsos (1. Jh.) in den Korintherbriefen und durch Tatian (2. Jh.), für den insbesondere die weibliche Sexualität die animalische Seite des menschlichen Wesens verkörperte, wofür er die Verführbarkeit durch die Schlange als Indiz betrachtete.
Augustinus interpretierte den Sündenfall in Hinblick auf die Sexualität neu: Demnach hätten die ersten Menschen im Paradies ihre Körperfunktionen noch völlig unter Kontrolle gehabt, die Zeugung habe zwar durch geschlechtliche Vereinigung stattgefunden, jedoch ohne sündige Wollust. Diese sei erst mit dem Sündenfall aufgetreten, und zwar als Strafe Gottes, um dem Menschen die Limitiertheit seines freien Willens vor Augen zu führen: „Wollust quält Menschen nicht nur von der Pubertät bis zum reifen Erwachsenenalter, sondern lebenslang und kann auch durch Askese und Körperzucht nicht besiegt werden.“ Nur durch die Rückkehr in jenen glückseligen, lustbefreiten Zustand vor dem Sündenfall könne das höchste Ziel der menschlichen Existenz, die Vereinigung mit Gott, annäherungsweise erreicht werden. Wer aber zu einer weitestgehenden Unterdrückung fleischlicher Begierden nicht in der Lage sei, solle wenigstens seine Seele mit Hilfe eines Ehepartners vor der ewigen Verdammnis bewahren, indem er seine Triebe ausschließlich zum Zweck der Zeugung von Nachkommen positiv einsetze – unter strengen Normvorgaben der kirchlichen Autoritäten. Damit wurde ‚die schönste Sache der Welt‘ zu einem notwendigen Übel degradiert, um den göttlichen Auftrag zur Vermehrung des Menschengeschlechts zu erfüllen, was ausschließlich im Rahmen der Ehe maßvoll und möglichst ohne Lustgefühle zu geschehen habe.
Freilich gab es auch andere Stimmen, die die Lust nicht ganz so verwerflich einschätzten, sondern ihr gar einen gewissen Sinn zugestanden: Für Hildegard von Bingen war die sexuelle Lust ein unverzichtbarer Faktor zur Festigung der Bindung der Ehepartner im von Gott gewollten Liebesakt, selbstverständlich auch bei ihr streng auf die Erfüllung des Fortpflanzungsgebots hin ausgerichtet. Das Breslauer Arzneibuch sieht das Phänomen Lust ganz nüchtern:
Di minne ist gelustlich dar umme. Daz si di lute vnde alle tir zu ir locke. Vnde in allin minnenclichen mut gebe. Die lute haben groz gelust an der minne. Vnde ist der lutzel die sie begen durch kinder wille.
Die Feststellung, dass Minne der Arterhaltung und der Triebbefriedigung dient, lässt am Beginn des 14. Jahrhunderts noch aufhorchen! Ähnlich realistisch sah später an der Schwelle zur Neuzeit der italienische Humanist Julius Caesar Scaliger (1484‒1558) die Funktion der Libido, nämlich als biologischen Anreiz zur Fortpflanzung, quasi als natürliches Belohnungssystem für die körperlichen Anstrengungen der Zeugung, Geburt und Aufzucht von Nachwuchs: „[W]enn man nicht durch jene Wollust gelockt würde, wie wenige würden da wohl den Koitus ausüben?“
[…]
Resümee und Ausblick
Sexuelle Reize sind multifaktoriell und ihre Evozierung durchaus situationsabhängig – es kommt also auf die passende Gelegenheit an, auf das Ambiente und die Stimmungslage unter Beteiligung aller Sinne. Das war im Mittelalter gewiss nicht anders als heute. Was als Aphrodisiakum gilt, beruht jedoch auf Konvention und ist kulturell bestimmt; eine wissenschaftliche Definition gibt es weder seitens der Pharmakologie noch der Medizin, daher ist die Frage, ob eine Substanz erotisierend wirkt, falsch gestellt – sie sollte vielmehr darauf abzielen, warum eine Substanz dafür gehalten und für diesen Zweck verwendet wurde/wird. Obwohl der wissenschaftliche Nachweis durch die Forschung bislang aussteht, wird bis heute gewissen Nahrungsmitteln eine stimulierende Wirkung zugesprochen. Diese Zuschreibung stützte sich schon immer zu einem guten Teil auf Empirie, egal ob die Ergebnisse systematisch verschriftlicht oder nur mündlich weitergereicht wurden. Der Rest ist Suggestion.
In diesem Beitrag wurde der gesamte Bereich der Arzneidrogen im engeren Sinn, der psychodelisch wirksamen Substanzen (Rauschdrogen) und der magischen Hilfsmittel bewusst ausgespart. Allein die Fahndung nach Hinweisen auf gustatorische Aphrodisiaka hat sich als sehr ergiebig erwiesen, wenn auch nicht in jenen Gebrauchstextsorten, die dafür prädestiniert erscheinen. Mit den in der Regimen-Literatur gewonnenen Einsichten sollte es nunmehr möglich sein, z. B. in den überlieferten Kochrezepttexten potenziell aphrodisierende Speisenkompositionen aufzudecken und ihre Wirkebene(n) zu definieren. Die eigentliche Interpretationsarbeit kann dann erst an diesem Punkt ansetzen, auch um hernach vielleicht noch besser zu erkennen, welcher Wahrheits- oder doch nur Wunschgehalt dem Sprichwort ‚Liebe geht durch den Magen‘ tatsächlich innewohnt.
[…]
Sie sind neugierig geworden? Das Buch erscheint im Dezember 2024 und kann hier vorbestellt werden.
| Zum Herausgeber |
| Dr. Jens Burkert studierte Geschichte, Deutsche Philologie mit Schwerpunkt Ältere Deutsche Literatur und Evangelische Theologie an der RWTH Aachen mit anschließender Promotion in Älterer Deutscher Literatur. Er arbeitet nach einer Reihe wissenschaftlicher Beschäftigungen an verschiedenen Universitäten nun im Lehr- und Forschungsgebiet Germanistik/Mediävistik der RWTH Aachen als Lehrkraft für besondere Aufgaben. |
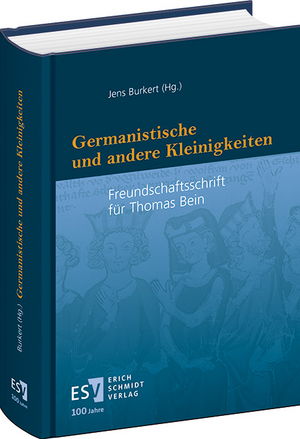 |
Germanistische und andere Kleinigkeiten. Freundschaftsschrift für Thomas Bein Herausgegeben von Jens Burkert Mit Beiträgen nicht nur aus der Germanistischen Mediävistik, sondern aus allen Bereichen der Germanistik und mit Ausflügen über die engeren Fachgrenzen hinaus spiegelt der Band Thomas Beins weitgefasste wissenschaftliche Interessen wider. Die ihm zu Ehren von Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern, Freundinnen und Freunden geschriebenen Beiträge umfassen ein entsprechend weites Spektrum - geeint durch das freilich lose Band (vermeintlicher) Kleinigkeit teils in der Abfassungsform, teils in der Beschäftigung mit wenig Beachtetem. Von antiker Ernährung über verschiedenste Genres mittelalterlicher Literatur, vom Renaissancehumanismus bis hin zu aktuellen Alltagsfloskeln und der Comicfigur Hägar werden vielfältige Gegenstände in den Blick genommen. Dass dabei nicht selten die Editorik in den Fokus gerät, ist eingedenk der Bedeutung dieses Gegenstands für Forschung und Lehre des hier Geehrten wie umgekehrt seiner Bedeutung für dieses Forschungsfeld kein Zufall. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik
