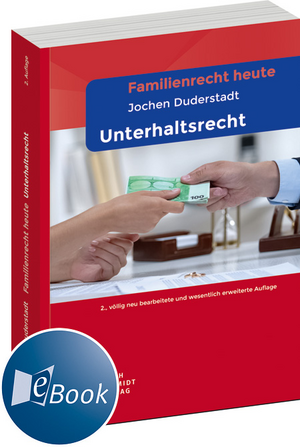Jochen Duderstadt: Die unterhaltsrechtlichen Implikationen des Wechselmodells sind so kompliziert, dass manche genervte Mutter schon zum Residenzmodell zurückkehren wollte (© Angela Kausche, Erich Schmidt Verlag)
Herr Duderstadt, fangen wir mit dem Scheidungs- und Unterhaltsrecht an. Auffällig sind unter anderem Änderungen beim Elternunterhalt nach der Reform durch das Angehörigenentlastungsgesetz. Was hat sich hierdurch im Wesentlichen geändert?
Jochen Duderstadt: Es können heute nur noch Kinder herangezogen werden, die mehr als 100.000 € brutto pro Jahr verdienen. Das sind etwa 6 % der Erwerbstätigen. Die anderen sind fein raus. Das Einkommen des Ehepartners spielt dabei keine Rolle mehr, d. h. die Gattin des Radiologen, die mit dessen goldener Kreditkarte durch die Edelboutiquen streunt, braucht keinen Cent zur Füllung der Pflegebedarfslücke ihrer dementen Mutter beizutragen. Das darf jetzt der Steuerzahler. Ich halte es für irrsinnig, solche höchstpersönlichen Pflichten, die ja dem Gebot der Rollentauschethik (und dem 4. der 10 Gebote!) entspringen, einfach zu vergesellschaften.
Das Wechselmodell: Umstritten und unterhaltsrechtlich kompliziert
Eine Woche bei Papa, die andere bei Mama. So etwa ließe sich das Wechselmodell bei Familien beschreiben, deren Eltern nicht zusammenleben. Was steht hinter dieser Idee und können Sie kurz umreißen, wie dieses Modell funktioniert?
Jochen Duderstadt: Grundidee ist die, dass kein Elternteil aus dem Leben der Kinder weitgehend ausscheiden soll. Die Kinder schwingen zwischen Vater und Mutter hin und her wie das Pendel einer Standuhr. Das ist m. E. unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll: Die Eltern müssen nah beieinander wohnen, sie müssen in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, weil das Wechselmodell teuer ist, und es muss vor allem dem Kindeswohl entsprechen, d. h. die Kinder müssen es mit tragen. Interessanterweise wird das Wechselmodell in der englischsprachigen Fachliteratur diskriminiert, und zwar mit dem Argument, es diene nur dem Elternbedürfnis nach Verteilungsgerechtigkeit, während die Kinder desorientiert seien. In Skandinavien dagegen kann man sich überhaupt auf die Straße trauen, wenn man sich gegen dieses Modell ausspricht.
Und welche unterhaltsrechtlichen Fragen stellen sich dabei?
Jochen Duderstadt: Oha! Das Rechenschema beim paritätischen, also symmetrischen Wechselmodell folgt den Regeln der Anteilshaftung und besteht aus mindestens 7 Rechenschritten. Bei jedem Schritt kann man sich heillos in die Wolle kriegen. Das heißt: Die unterhaltsrechtlichen Implikationen des Wechselmodells sind so kompliziert, dass manche genervte Mütter schon die Rückkehr zum Residenzmodell angestrebt haben, um wieder klare Verhältnisse zu schaffen: Der eine zahlt, der andere betreut (Gleichwertungsregel). Der Witz ist: Wenn die Eltern in einer Zuverdienstehe leben – das ist der statistische Normalfall – und die Mutter ca. 1.000 € netto pro Monat weniger verdient als der Vater, aber das staatliche Kindergeld bezieht, kommt kaum was für sie heraus: Der Berg kreißt und gebiert ein Mäuslein. Jeder vernünftige Geschiedene, der nicht durch den Partnerkonflikt noch völlig vernebelt ist, vereinbart Folgendes: Die Frau behält das Kindergeld (immerhin 250 € pro Nase), keiner kriegt Kindesunterhalt vom anderen, und wenn Sonderbedarf eintritt, übernimmt ihn der Besserverdienende.
Ein weiterer Witz des Ganzen besteht darin, dass die Anteilshaftung nur für die identischen Betreuungsanteile gilt: Wenn z. B. der Vater einen Anteil von 40 % hat, sagt ihm der der BGH, dass er allein für den Barunterhalt zuständig ist und sich gefälligst darüber freuen soll, dass er so ein großzügiges Umgangsrecht genießt. So was untergräbt das Vertrauen in die Rechtspflege.
| Jochen Duderstadt |
- Fachanwalt für Familienrecht in Göttingen sowie Notar a. D.
- Er praktiziert und publiziert seit mehr als vier Jahrzehnten. Daneben ist er als Dozent an Fortbildungsinstituten für Fachanwälte tätig.nfokasten Beschreibungstext.
|
Systemwechsel beim Ehegattenunterhalt
Beim Ehegattenunterhalt gab es Änderungen, die auch als Systemwechsel bezeichnet werden. Gemeint ist die Berücksichtigung des Naturalunterhalts anstelle einer Monetarisierung der Kinderbetreuung. Können Sie dies grob skizzieren?
Jochen Duderstadt: Das ist ein besonders trostloses Kapitel. Wegen der Gleichwertungsregel, die ja im Gesetz steht (§ 1606 III 2 BGB), müsste eigentlich jede Frau das Recht haben, von ihrem Nettoeinkommen den monetarisierten Betreuungsunterhalt abzuziehen. Der Vater macht das ja auch mit dem Barunterhalt für die Kinder. Das gilt beim Elternunterhalt und beim Volljährigenunterhalt.
Da weigert sich der BGH aber mit beispielloser Sturheit, den betreuenden Müttern das gleiche Recht zu gewähren. Stattdessen gönnt er den Müttern eine Art Trostpflaster: Sie dürfen nun von ihrem Einkommen die Differenz zwischen dem Kindesunterhalt, den Papa zahlt, und dem sog. Vollunterhalt (der orientiert sich am zusammengerechneten Einkommen beider Eltern wie beim VU) abziehen, und zwar zur Abgeltung des Naturalunterhalts, den betreuende Mütter sowieso nicht schulden. Das führt dann im Regelfall dazu, dass ihr Unterhalt – Trommelwirbel, Fanfarenstöße – sich um einen mittleren zweistelligen Betrag pro Monat erhöht. Bei Lichte besehen ist das eine kümmerliche Teilmonetarisierung der mütterlichen Care–Arbeit.
Zugewinnausgleich und gemeinsame Schulden
Kommen wir zum Vermögensrecht. Nicht selten begegnet man dem Begriff „Negativer Zugewinnausgleich“. Gibt einen Solchen überhaupt?
Jochen Duderstadt: Nein, das ist ein Juristenscherzwort, denn die Schulden werden sowieso beim Zugewinnausgleich berücksichtigt: Anfangs– und Endvermögen werden immer saldiert. Wenn Sie zu Beginn der Ehe gar nichts und im Endvermögen ein Aktienpaket mit einem Kurswert von 100.000 € und Schulden i. H. v. 60.000 € haben, beträgt der Zugewinn 40.000 €.
Gemeint ist etwas Anderes, nämlich die Frage, wer die gemeinsamen Schulden trägt, also die gesamtschuldnerischen Verbindlichkeiten, wie die Juristen sagen. Da gilt eigentlich das Halbe–Halbe–Prinzip nach § 426 BGB, aber das ist nur eine Hilfsauslegungsregel, von dem es eine Trias von Abweichungen gibt: Anderweitige Vereinbarung, Treu und Glauben und Natur der Sache.
Wie werden Kreditraten für die vorher gemeinsam genutzte Wohnimmobilie behandelt?
Jochen Duderstadt: Kommt darauf an, was mit dem Wohneigentum nach der Scheidung passiert! Wenn das Haus an einen beliebigen Dritten verkauft wird, werden die Schulden beglichen; den Resterlös teilen sich die Eheleute. Wenn einer von beiden das Haus allein nutzt, muss er auch die Schuldraten zahlen, unabhängig davon, ob er Volleigentümer geworden ist oder nicht.
Kann man vermögensrechtliche Ansprüche auch verwirken?
Jochen Duderstadt: Oh ja. Die Hürden sind allerdings höher als etwa bei der Verwirkung des Nachscheidungsunterhalts. Man muss schon eine Bluttat begehen oder eine Verwandte der Frau vergewaltigen oder etwas ähnlich Schlimmes anrichten, z. B. – so eine Entscheidung des OLG Celle aus dem Jahre 1979, die immer noch durch die Kommentarliteratur geistert – dem Ehemann in 11 Jahren 4 Kinder gebären, die von 4 Männern stammten, nur nicht von ihm. Offenbar war sie ihrem mitteleuropäischen Beuteschema treu geblieben, sonst wäre es eher herausgekommen.
Kindschaftsrecht – Aktuelle Entwicklungen im Sorge- und Umgangsrecht
Webinar mit Jochen Duderstadt, Fachanwalt für Familienrecht und bis 2017 Notar in Göttingen
Fr 6. September 2024, 9:00-14:30 Uhr – 5 Zeitstunden nach § 15 FAO
Das Webinar behandelt die jüngere Rechtsentwicklung und Rechtsprechung zur elterlichen Sorge und zum Umgangsrecht in zwei Teilen:
In Teil 1 „Sorgerecht“ setzt der Referent folgende Schwerpunkte:
- Gemeinsames Sorgerecht
- Kriterien der Alleinsorge, von der Elterlichkeit bis zur Bindungstoleranz
- Exkurs zur Religionszugehörigkeit
- Entscheidungsbefugnis in Alltagsfragen (Abgrenzungsproblematik)
Im zweiten Teil „Umgangsrecht“ geht es vor allem um
- die Kinderbetreuungsmodelle, insbesondere das Wechselmodell mit seinen unterhaltsrechtlichen Implikationen,
- die Bringschuldproblematik,
- den Umgangsrechtsausschluss im Lichte der kaum noch überschaubaren Rechtsprechung, und die
- Umgangssabotage samt ihren Rechtsfolgen.
Direkt zur Anmeldung
|
Gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall
Gestritten wird oft auch um die elterliche Sorge. Lässt sich sagen, dass das gemeinsame Sorgerecht der Regelfall und die Alleinsorge die Ausnahme ist?
Jochen Duderstadt: Na ja, der BGH meint, dass es da keine Regel–Ausnahme–Verhältnis gibt, was sich m.E. mit § 1626 I BGB nicht in Einklang bringen lässt. Fest steht: die gemeinsame elterliche Sorge ist der statistische Regelfall. Das gilt immer, also vor und nach der Scheidung, und es gilt auch für die nichteheliche Lebensgemeinschaft: Da hat zwar die Mutter zunächst einmal die Alleinsorge, aber der Vater kann ohne Weiteres in einem einfachen Verfahren vor dem Familiengericht die Mitsorge beantragen. Da findet dann nur eine sog. negative Kindeswohlprüfung statt, d.h. das Gericht checkt, ob er ein ausgewiesener Rabenvater ist.
Die Mitsorge wird einem Elternteil nur genommen, wenn sein Verhalten extrem kindeswohlschädlich ist, etwa bei sexuellem Missbrauch, Paranoia mit fremdaggressiven Durchbrüchen oder beim Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Oder wenn beide Eltern zwar erziehungsfähig sind, aber nicht miteinander kooperieren und kommunizieren können.
Und was sind die Kriterien für die Alleinsorge?
Jochen Duderstadt: Da gibt es einen ganzen Strauß:
Elterlichkeit, innere Bindung, positive Kontinuität, Geschwisterverhältnis, Kindeswille, Förderung, Erziehungsfähigkeit, Gesundheitszustand der Eltern, Bindungstoleranz.
Noch ein paar Worte zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft: Gibt es Vorsorgemaßnahmen und Hilfestellungen, dies Sie dem wirtschaftlich schwächeren Partner empfehlen können?
Jochen Duderstadt: Den Mietvertrag mitunterschreiben, keine Schulden eingehen für das Vermögen des Partners, Testament für den Partner/die Partnerin machen oder zum Allermindesten eine Lebensversicherung abschließen, mit unwiderruflicher Bezugsberechtigung des Lebenspartners bzw. der Partnerin. Ein Testament ist wichtig, weil es in der NLE kein gesetzliches Erbrecht gibt. Aber selbst wenn man testamentarischer Alleinerbe ist, besteht kein Grund zum Jubel, denn die Erbschaftssteuer beträgt 30%.
| Der kostenlose Newsletter Recht – Hier können Sie sich anmelden! |
Redaktionelle Meldungen zu neuen Entscheidungen und Rechtsentwicklungen, Interviews und Literaturtipps.
|
Reformbedarf
Ihr Ausblick: Welche Reformen stehen gegenwärtig an und halten Sie diese für notwendig?
Jochen Duderstadt: Im Familienrecht haben wir im Schnitt alle 10 Jahre eine sog. Jahrhundertreform, und ich würde es begrüßen, wenn mal Ruhe einkehrte.
In Teilbereichen herrscht allerdings tatsächlich Reformbedarf, etwa beim Scheinvaterregress. Nehmen Sie an, ein untadeliger Vater kriegt eines Tages heraus, dass sein Sohn gar nicht von ihm stammt. Dann kann er vom biologischen Vater den Kindesunterhalt für die Vergangenheit fordern. Aber dafür muss er erst mal wissen, wo seine Frau über den Zaun gefressen hat. Den Auskunftsanspruch hat er bisher nicht. Die Reform, die seit 2016 in Berlin in den Schubladen liegt, soll das ändern. Allerdings soll der Scheinvater den Erzeuger dann nur noch für 2 Jahre Regress nehmen können.
Dann haben wir die Reform des Namensrechts, die schon den Bundestag passiert hat. Die ist m. E. überflüssig und in Teilbereichen sogar schädlich, weil sie das Tor zu den mehrgliedrigen Kindesnamen wieder weit aufstößt. Die Reform sieht zweigliedrige Namen vor. Nach der nächsten Reform haben wir dann vielleicht viergliedrige. Nehmen Sie an, Madleen Bischof–Häger heiratet Jerome Wallach–Stein. Dann heißt ihr Sprössling vielleicht eines Tages Samira Wallach–Bischof–Stein–Häger. Erbarmen!
Und dann kommt noch das Eckpunktepapier des Justizministeriums zur Reform des Kindschaftsrechts. Die Fachwelt betrachtet das Vorhaben überwiegend sehr kritisch, und zwar als nicht praxistauglich, zum Teil überflüssig, zum Teil halbherzig. Kern ist eine Stärkung der Kinderrechte und die Überleitung von hoheitlichen sorgerechtlichen Regelungen in die Privatautonomie: Die Eltern sollen künftig entscheiden können, dass einer von beiden die Alleinsorge bekommt. Mich wundert, dass noch niemand auf den naheliegenden Gedanken gekommen ist, dass es sich dabei um einen Vertrag zulasten Dritter handelt, nämlich zulasten der Kinder. Dass ein solcher Vertrag unzulässig ist, steht in jedem BGB–Kommentar. Den Kindern wird hinter ihrem Rücken ein Mitverantwortlicher genommen, also aus ihrem Leben herausgekegelt. Das darf nicht sein.
So, liebe Leute, ich hoffe, dass ich nach Ihrem Eindruck nicht allzu hart ins Gericht gegangen bin mit dem Gesetzgeber und der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Es gilt ja der alte Schnack „2 Juristen, 3 Meinungen“, und auch ich habe nicht den tiefen Teller erfunden. Wer sich in die Materie hineingekniet hat, mag sich eine eigene Meinung bilden und ist herzlich eingeladen, mir zu widersprechen. Nur so kann es in der Rechtsentwicklung Fortschritt geben.
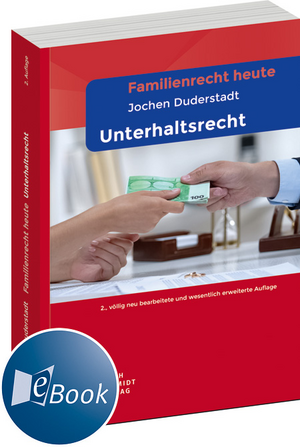 |
Eine ausführliche Darstellung des gesamten materiellen Unterhaltsrechts, angereichert mit zahlreichen Beispielen aus der neuesten Rechtsprechung und vielen pointierten, kritischen Stellungnahmen. In der 2. Auflage rundum aktualisiert, beleuchtet Jochen Duderstadt alle dabei relevanten materiellrechtlichen und die wichtigsten prozessualen Probleme, die sich um einen Unterhaltsstreit ranken können. Schwerpunkte und besondere Einzelaspekte sind:
- Einkommenslehre einschließlich Schuldenberücksichtigung
- Einschlägige unterhaltsrechtliche Konstellationen: Minderjährige und volljährige Kinder gegen ihre Eltern, Eltern gegen Kinder, Kinder gegen Großeltern, unverheiratete Mütter gegen Väter, geschiedene Ehepartner gegeneinander (mit Verwirkungsproblematik)
- Aktuelle Berechnungsbeispiele unter Berücksichtigung der Kindergelderhöhung, des Bürgergeldes und der neuen Düsseldorfer Tabelle – auch zum besseren Verständnis besonders schwieriger Konstellationen wie z.B. der Anteilshaftung beim Volljährigenunterhalt, beim Elternunterhalt und beim Wechselmodell
- Scheinvaterregress und Auskunftsansprüche
- Steuerliche und vollstreckungsrechtliche Fragen
Vollständigkeit, fachübergreifende Ansätze und last but not least der unterhaltsame Stil machen das Buch zu einer leicht zugänglichen Arbeitshilfe – für Juristen wie Nichtjuristen!
Aus dem Praxiswerk „Familienrecht heute“. Weitere Bände des Gesamtwerks widmen sich den Scheidungsfolgesachen, dem Vermögensrecht und dem Kindschaftsrecht sowie grundlegend dem Thema Scheidung und Scheidungsfolgen.
|
| Verlagsprogramm |
Weitere Nachrichten aus dem Bereich Recht
|
(ESV/bp)