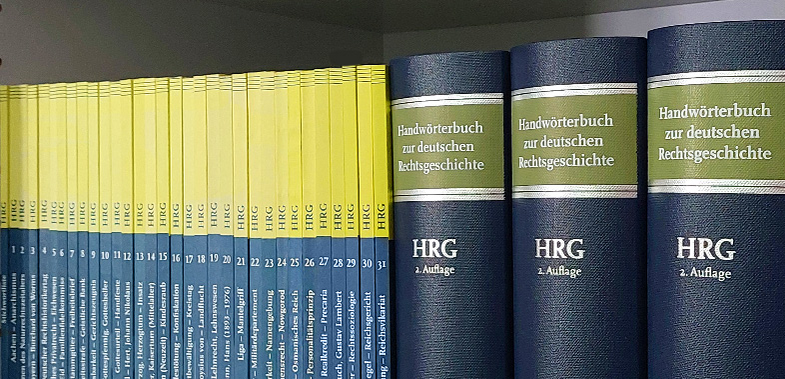
Neues aus dem HRG
Nachlesen können Sie das und mehr in zwei Auszüge aus der 32. Lieferung: Wir haben die Beiträge „Richtschwert“ (von Prof. Dr. Andreas Deutsch) und „Reinigungseid“ (von Anika M. Auer) hier für Sie zur Lektüre eingestellt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Richtschwert
Als Richtschwert wird das Schwert eines Scharfrichters (Henker) bezeichnet, mit dem dieser die Todesstrafe durch Enthaupten sowie zum Teil auch Verstümmelungsstrafen vollstreckte. Im deutschsprachigen Raum wurden Köpfungen bis zur allmählichen Etablierung der Guillotine (ab 1792) vornehmlich mit dem Schwert durchgeführt; für Leibesstrafen wie Finger- oder Handabhacken wurde hingegen auch das Beil benutzt.
Der Scharfrichter führte die Enthauptung im Stehen durch, wobei der Hinzurichtende meist auf dem Boden kniete oder saß. Um die Halswirbel nach Möglichkeit mit einem Hieb zu durchtrennen, war nicht nur besondere Fertigkeit des Scharfrichters gefragt. Hierfür durfte das Richtschwert einerseits nicht zu schwer sein, oft wog es ca. 5 kg. Andererseits musste es beim Schwungholen genügend Wucht entwickeln und einen gleichmäßigen Schlag ermöglichen, wofür Ausbalancierung und Länge wichtig waren.
Üblicherweise verfügte ein Richtschwert über eine flache, breite, zweischneidige Klinge von 80–100 cm Länge mit zumeist gerundeter oder abgeflachter Spitze (sog. Ort). Zwischen dem meist etwa 25 cm langen Griff (sog. Heft) und der oft mit einer Blutrinne versehenen Klinge war eine in der Regel gerade, meist ca. 20 cm lange Parierstange als Handschutz eingebaut. Hauptherstellungsort der Richtschwerter war Solingen.
Das Richtschwert konnte sich im Eigentum der betreffenden Stadt bzw. Herrschaft oder des Scharfrichters selbst befinden. Für die Inhaber der Blutgerichtsbarkeit war das Richtschwert ein Symbol der Justizhoheit. Manche Richtschwerter waren kunstvoll ausgestaltet, u.a. mit Ätzbildern oder (zum Teil silbern oder golden ausgeschlagenen) Gravuren auf den Klingen. Eingraviert waren außer Namen oder Monogrammen der Besitzer verbreitet Sprüche, welche häufig die (an sich gegen das fünfte Gebot verstoßende) Tötung durch den Henker rechtfertigen sollten. Daneben fanden sich auch bildliche Darstellungen etwa von Hinrichtungsszenen, Wappen, Heiligen, Allegorien oder Wahrzeichen der betreffenden Stadt. Vom Richtschwert zu unterscheiden ist das Gerichtsschwert, das bei Sitzungen eines Halsgerichts als Symbol der Hochgerichtsbarkeit auslag oder vom Richter gehalten wurde (vgl. Art. 82 CCC).
| Das könnte Sie auch interessieren: | 23.05.2022 |
| Von Rädelsführer bis Rechtssoziologie | |
 |
Die 29. Lieferung des „Handwörterbuchs zur deutschen Rechtsgeschichte“ ist soeben erschienen. Die Lieferung hält Beiträge zu mehreren Dutzend rechtsgeschichtlich relevanten Stichwörtern zwischen „Rädelsführer“ und „Rechtssoziologie“ bereit. Einiges glaubt auch der Laie zu kennen – oder hat zumindest eine Vorstellung davon, was gemeint sein könnte, wenn man von „objektivem Recht“ spricht. Anderes hingegen erweckt sogenannte ‘Aha’-Effekte beim Lesen: mehr … |
Reinigungseid
I. Allgemeines
Das Ablegen von Eiden ist seit der Antike und in fast allen Kulturen in mannigfacher Gestalt geläufig, ob als Eidesleistung in Gerichtsverfahren, als Treueid gegenüber einem Herrscher, als Treueschwur bei Trauungen oder bei Einführungen in Ämter. Werden Eide geschworen, so erfolgt dies meist öffentlich und unter Einbeziehung zuvor festgelegter Rituale, in die häufig Gebärden (Schwurhand) oder Gegenstände – im Christentum die Evangelien (Bibel), Kreuze oder Reliquien – eingebunden sind. Die Einbettung in zeremonielle Vorgänge sollte den Beteiligten die Wirkkraft sowie die durch Meineid (periurium) angedrohten Konsequenzen (beispielsweise Freiheitsstrafe n. § 154 im heutigen deutschen Strafgesetzbuch) einer unter feierlichem Eid geleisteten Aussage ins Bewusstsein rufen.
II. Ablauf
Eine bes. Form des Eides stellte der Reinigungseid (iuramentum purgatorium) im MA und der frühen NZ dar. Sowohl in weltlichen als auch kirchlichen Verfahren kam der Reinigungseid als ein „als Schwur formuliertes Unschuldsbekenntnis“ (Kölmoos) zum Einsatz, durch das ein freier Mensch Leben und Leib sowie seine Ehre verteidigen konnte. Bereits im frühen MA ist der R. in den Stammesrechten überliefert. Das Ablegen des R. erfolgte im öffentlichen Raum und war streng rituell: Die Eidesformel wurde dem Schwörenden bei vorgehaltenem Stab vorgesprochen und musste Wort für Wort wiederholt werden. Eine fehlerhafte Wiedergabe wurde als Meineid angesehen und mit Strafen sanktioniert, etwa in den karol. Kapitularien oder im Schwabenspiegel mit dem Abschlagen der Hand oder des Schwurfingers (Luminati).
III. Anwendung
Eingesetzt wurde der R. in Fällen, die nicht allein durch Zeugenaussagen oder andere Beweismittel geklärt werden konnten. Ausgeführt wurde der R. von den Beklagten selbst, und zwar als eine Art Selbstverfluchung: Die schwörende Person garantierte öffentlich die Richtigkeit und Reinheit des Eides und übergab sich feierlich der „beschworenen“ Gewalt, also entweder Gott selbst oder den angerufenen Heiligen, die eine unwahre Aussage ahnden und Eidbruch und Falschheit (Meineid) bestrafen sollten.
Obwohl im MA die Kirchenväter und viele Geistliche dem Ablegen von Eiden generell eher ablehnend gegenüberstanden, fand der R. in Form eines Treueversprechens gegenüber dem Papst sowie als Unschuldsbeteuerung von Klerikern Eingang in das Kanonische Recht (purgatio canonica). So legte z.B. Papst Leo III. im Dezember 800 im Kontext der Kaiserkrönung von Karl dem Großen auf einer Synode in der Peterskirche in Rom in Anwesenheit des fränk. Herrschers einen R. ab und läuterte sich auf diese Weise von gegen ihn erhobenen Anschuldigungen.
In weltlichen Verfahren kam dem Reinigungseid bes. im Strafrecht eine bedeutende Rolle zu. Im Akkusationsprozess galt, dass ein eidfähiger Beklagter einen R. vollziehen und sich dadurch von bösem Leumund ebenso wie von Anklagen widerrechtl. Handlungen unterschiedlicher Art oder anderen Schuldvorwürfen wie Diebstahl und Raub reinigen oder auch die Schuldenfreiheit eines Erblassers (so im Sachsenspiegel Ldr. III 11) bezeugen konnte. Dies geschah je nach sozialer Stellung des Beschuldigten bzw. nach Schwere der Vergehen entweder allein oder mithilfe von Eideshelfern, die nach dem Ablegen eines R. mit eigenen Eiden beschworen, dass der Beklagte aufrichtig und rein, also nicht meineidig, geschworen hatte.
War es einem Beschuldigen nicht möglich, seine Unschuld durch einen Reinigungseid zu belegen – z.B., wenn ein Fremder keine Eideshelfer herbeibringen konnte –, wurde bis ins 13. Jh. hinein auf Gottesurteile rekurriert. Im langobard. Italien galt neben dem R. lange der Zweikampf als Mittel der Reinigung bei vielen Rechtsstreitigkeiten. Auch in Skandinavien nahm der Eid eine wichtige Stellung ein; er galt als wichtigstes Beweismittel für die Klägerpartei, insbes. jedoch für den Beschuldigten, der sich durch den R. von einer Anklage befreien konnte. So gibt es beispielsweise frühma. Rechtstexte aus Island und Irland, die vorsahen, dass in Fällen strittiger Paternität Frauen, die keinen Eid ablegen durften, die Vaterschaft eines Kindes durch Gottesurteile beweisen mussten, Männer hingegen durch einen R. abstreiten konnten, der Vater des Kindes zu sein. In Frankreich war der R. in den Offizialaten ein häufiges Beweismittel und auch im weltlichen Gerichtswesen anzutreffen, bis er von Kg. Philipp III. 1280 für die Gascogne und später im ganzen Reich untersagt wurde. Auch in England war der R. bis ins 13. Jh. zur Klärung leichterer Vergehen möglich.
Obwohl Juden generell von der Ausübung von Gottesurteilen ausgeschlossen waren, konnten sie in Verfahren dennoch auf den Reinigungseid zurückgreifen. Für die jüd. Gemeinde in Speyer wurde 1084 ein Privileg erlassen, worin neben dem Verbot von Zwangstaufen ebenfalls geregelt wurde, dass bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Juden und Christen R. und Zeugenbeweis zugelassen waren (Kisch, 54). Einige Bestimmungen, so im Schwabenspiegel oder in einigen Stadtrechten (z.B. in Zürich), sahen vor, dass die Schwörenden während der Eidesleistung auf einer Schweinehaut stehen mussten, was auf eine Erniedrigung abzielte (Luminati).
Aus dem ersten Drittel des 14. Jh. ist nach Bescheid des Magdeburger Schöffenstuhls für die Schöffen zu Stendal überliefert, dass ein Jude vor der Synagoge einen R. auf den Tanach (up Moyses buͦch), die Sammlung heiliger hebräischer Schriften, ablegen sollte, um sich von dem Vorwurf eines Verbrechens, das er an einem Christen verübt haben sollte, zu reinigen. Die Eideshelfer sollten jeweils zu dritt schwören: Des spreke wy vor eynt recht: Dat, de joden de mit der kamwordighen wuden be ruch tighet unde be claghet sin scolen der wu[n]den unsculdich werden vor der joden scole jowelk selve sevede mit joden, nach erme jodeschen rechte, he vore mit sines selves hant unde na dre unde echt dre alse recht is. (Stendaler Urtheilsbuch, Nr. 10).
IV. Aufhebung
Der Reinigungseid war bis ins ausgehende MA als Beweismittel in Verfahren zugelassen. So findet sich beispielsweise noch 1525 in den Amtsbüchern im fränk. Neuhof an der Zenn im Verzeichnis des Propstes der Hinweis, dass sowohl die Bevölkerung von Neuhof als auch die der dazugehörigen Dörfer einen Reinigungseid ablegen mussten. Durch den Reinigungseid sollten die Bewohner beweisen, dass sie weder an Zusammenkünften des Schwäbischen Bundes noch an bäuerlichen Unruhen beteiligt waren.
Insgesamt ist aber zu beobachten, dass Beweismittel wie Gottesurteil und R. seit dem späten 12. und frühen 13. Jh. zunehmend in die Kritik gerieten und verboten wurden. So untersagte das IV. Laterankonzil 1215 Geistlichen die Teilnahme an Gottesurteilen. Auch der Reinigunsgeid wurde schließlich vor geistlichen und weltlichen Gerichten obsolet, denn mit der Abkehr vom Akkusations- hin zum Inquisitionsprozess zu Beginn der Frühen NZ traten vor Gericht andere Beweismittel wie der Urkundenbeweis, Zeugenaussagen oder die Hinzuziehung von Sachverständigen in den Vordergrund und die Richter sprachen das Urteil nach Ablegen eines Geständnisses, das lange auch durch den Einsatz der Folter herbeigeführt werden konnte, aus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Falls Sie neugierig geworden sind: Die aktuelle 32. Lieferung und alle 31 vorher erschienenen können Sie hier bei uns bestellen.
Das Handwörterbuch liegt zudem auch als Datenbank vor, sodass Sie auch bequem online recherchieren und lesen können. Fragen Sie Ihre Bibliothek – wir bieten auch Campuslizenzen an!
Programmbereich: Rechtsgeschichte

