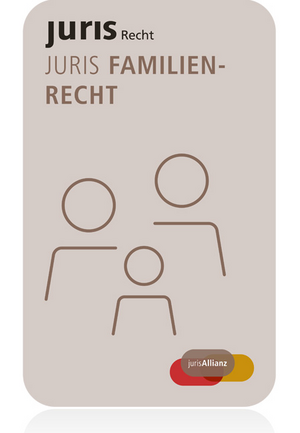Der Antragsteller erfuhr erst durch den Abstammungstest eines Labors, den er selbst beauftragte, dass er nicht der Vater seiner dunkelhäutigen Kinder ist (Bild: Sherry Young / stock.adobe.com)
Fristbeginn für Anfechtung einer Vaterschaft
OLG Celle zur Vaterschaftsanfechtung aufgrund abweichender Hautfarbe der Kinder
ESV-Redaktion Recht
28.04.2025
Wer seine Vaterschaft anfechten will, muss dieses innerhalb von zwei Jahren tun, nachdem er von den Umständen erfahren hat, die gegen die Vaterschaft sprechen. Beginnt die Frist aber schon dann zu laufen, wenn bei der Geburt des Kindes sichtbar wird, dass das Kind eines weißen Vaters dunkelhäutig ist? Zu dieser Frage hat sich das OLG Celle in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss geäußert.
In dem Streitfall zweifelte der spätere Antragsteller daran, dass seine beiden dunkelhäutigeren Kinder – die 2011 und 2016 geboren wurden – von ihm sind. Er meinte, dass Kinder, die von einer schwarzen Frau und einem weißen Mann stammen, hellhäutiger sein müssten als die Mutter. Verstärkt wurden seine Zweifel dadurch, dass auch Freunde von ihm dieser Ansicht waren, die ihn dies aber erst nach der Trennung von seiner Frau im Jahr 2023 wissen ließen.
Daher entschloss sich der Antragsteller dazu, seine Vaterschaft vor dem Amtsgericht/Familiengericht Uelzen (kurz AG Uelzen) anzufechten. Seinen entsprechenden Antrag stellte er unter der Bedingung der Gewährung von Verfahrenskostenhilfe.
AG Uelzen: Antragsteller kannte bereits ab der jeweiligen Geburt der Kinder die Umstände, die gegen seine Vaterschaft sprechen
Das AG Uelzen lehnte die Bewilligung jedoch mit Beschluss vom November 2023 endgültig ab. Die Begründung: Der Antragsteller habe die Anfechtungsfrist von zwei Jahren versäumt. Schließlich wären ihm schon bei der Geburt der Kinder – aufgrund deren Hautfarbe – Umstände bekannt gewesen, die hinreichende Zweifel an seiner Vaterschaft aufkommen lassen. Damit sei die Anfechtungsfrist abgelaufen. Gegen die Entscheidung des AG Uelzen wendete sich der Antragsteller mit einer Beschwerde an das OLG Celle.
Antragsteller: Hinreichende Zweifel an Vaterschaft erst mit Kenntis der Ergebnisse der betreffenden Gutachten begründet
Im Beschwerdeverfahren Verfahren trug der Antragsteller dann weiter vor, dass er im Dezember 2023 ein Abstammungsgutachten erstellen ließ. Aus diesem habe sich ergeben, dass er tatsächlich nicht der leibliche Vater ist. Der Antragsteller meint, dass er erst mit dem Ergebnis dieser Gutachten hinreichende Kenntnis von den maßgeblichen Umständen seiner vermeintlichen „Vaterschaft“ erlangt habe. Damit würde die Anfechtungsfrist auch erst mit Kenntnis der Gutachten anfanngen zu laufen.
| Der kostenlose Newsletter Recht – Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! |
Redaktionelle Meldungen zu neuen Entscheidungen und Rechtsentwicklungen, Interviews und Literaturtipps
|
OLG Celle: Abweichende Hautfarbe der Kinder allein begründet noch keine ausreichenden Zweifel an der Vaterschaft
Seine Beschwerde hatte vor dem Senat für Familiensachen des OLG Celle Erfolg. Der Senat änderte den Beschluss der Ausgangsinstanz ab und bewilligte dem Antragsteller Verfahrenskostenhilfe ohne Festsetzung von Raten. Die wesentlichen Erwägungen des Senats:
Kenntnisse über Vererbung bei Laien unzurreichend
Eine abweichende Hautfarbe des Kindes von der des Vaters kann nur in seltenen Ausnahmefällen Zweifel an der Vaterschaft begründen, die für einen Anfangsverdacht ausreichen, der den Lauf der Anfechtungsfrist in Gang setzt. Den Grund hierfür sieht der Senat darin, dass die Kenntnisse von Laien nicht ausreichen, um die komplexe Vererbung der Hautfarbe ausreichend bewerten zu können.
Wissenschaftliche Grundlagen der Vererbung
Um diese Einschätzung zu begründen, stieg der Senat tiefer in die Grundlagen der Vererbung ein und betonte, dass die Hautfarbe polygen vererbt wird. Es sind also zahlreiche Gene an der Bildung der Hautfarbe beteiligt. Um dies zu verdeutlichen, ging der Senat auf einen Bericht der Ärztezeitung vom Juli 2008 ein. Dieser berichtete über eine Geburt von Zwillingen mit unterschiedlichen Hautfarben. Demnach sind an der Bildung der Hautfarbe zwischen 10 und 100 Gene beteiligt.
Zwar, so der Senat weiter, würden dunklere Hautfarben meistens dominant vererbt – dennoch sei es möglich, dass ein Kind von einem hellhäutigen Elternteil eine dunkle Hautfarbe hat, ohne dass dies gegen eine genetische Abstammung spricht. Damit könne die Hautfarbe allein keinen sicheren Hinweis auf eine fehlende Abstammung geben.
Anfechtungsfrist beginnt nicht mit der Geburt
Nach den weiteren Ausführungen des Senats begann die Anfechtungsfrist damit nicht schon mit der bloßen Kenntnis der Hautfarbe der Kinder bei der Geburt zu laufen. Vielmehr erfordert der für die Vaterschaftsanfechtung erforderliche Anfangsverdacht nach § 171 Abs. 2 Satz 2 FamFG mehr als nur die Aufzählung der Hautfarben der Beteiligten. Die für den Verdacht notwendige Sicherheit ergibt sich deshalb erst aus einem gesicherten Abstammungsgutachten, führt der Senat dazu aus.
Wie es weitergeht
Der Beschluss des OLG Celle ist für den Vater aber nur ein Etappensieg, und zwar aus folgenden Gründen:
- Zwei gesonderte Verfahren: Zunächst stellte der Senat klar, dass für jedes Kind ein gesondertes Verfahren durchzuführen ist. Hierzu müsse das AG Uelzen das Anfechtungsverfahren für eines der beiden Kinder nach § 20 FamFG abtrennen.
- Zum Verwertungsverbot der Abstammungstests: Die vom Vater vorgelegten Abstammungstest unterliegen nach Senatsauffassung auch keinem Verwertungsverbot. Dies wäre nur dann anders zu bewerten, wenn die DNA-Analysen als „heimliche Vaterschaftstests“ unzulässig gewesen wären – und zwar aufgrund der Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Kinder. In diesem Fall könnten die Analysen auch nicht als Grundlage für den substantiierten Vortrag eines Beteiligten zum Anfechtungsverdacht dienen. Hiervon ging der Senat nach Vorlage der Gutachten aber nicht aus. Demnach lagen dem Labor die Identitätsbestätigungen, die Probeentnahmeprotokolle sowie die Einwilligungen der Beteiligten in die Tests vor. Allerdings muss die Vorinstanz im Hauptsacheverfahren prüfen, ob die Zustimmung der Kindesmutter zur Entnahme des genetischem Materials bei den Kindern möglicherweise unwirksam und das Gutachten daher nicht verwertbar ist.
- Vertretungsbefugnis der Mutter: Darüber hinaus muss das AG Uelzen noch prüfen, ob die Kindesmutter die betroffenen Kinder in der Hauptsache vertreten darf. GGf. sei ein Ergänzugspfleger einzuschalten, meint der Senat abschließend.
Quelle:
Beschluss des OLG Celle vom 16.12.2024 – 21 WF 178/23
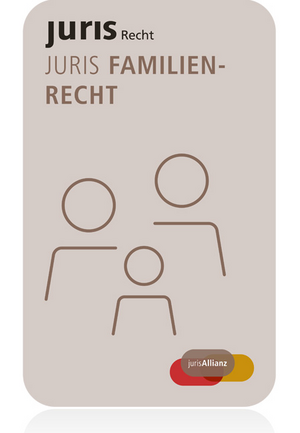 |
Jetzt gratis testen: Lernen Sie juris Familienrecht für 4 Wochen kostenlos, unverbindlich und ohne Risiko kennen.
Mit juris Familienrecht durchsuchen Sie führende Grundlagenwerke der jurisAllianz Partner zum gesamten Rechtsgebiet und klären sämtliche Fragestellungen inklusive der Querverbindungen zum Erb- und Steuerrecht. Sie greifen außerdem auf die aktuellen Unterhaltstabellen zu und finden problemlos alle Entscheidungen, die Sie kennen müssen.
juris Familienrecht enthält folgende Werke aus dem Erich Schmidt Verlag:
- FamFG, Kommentar, von Dr. Dirk Bahrenfuss (Hrsg.)
- Der Versorgungsausgleich von Hartmut Wick
- Einstweiliger Rechtsschutz in Familiensachen von Hans-Joachim Dose und Dr. Bettina Kraft
- Familienrecht heute Kindschaftsrecht von Jochen Duderstadt
- Familienrecht heute Scheidung und Scheidungsfolgen von Jochen Duderstadt
- Familienrecht heute Unterhaltsrecht von Jochen Duderstadt
- Familienrecht heute Vermögensrecht von Jochen Duderstadt
|
| Verlagsprogramm |
Weitere Nachrichten aus dem Bereich Recht
|
(ESV/bp)
Programmbereich: Bürgerliches Recht, Zivilverfahrensrecht