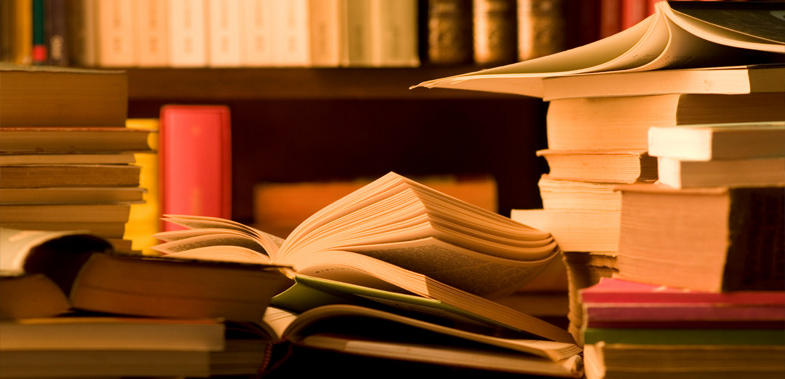
Theorie und Literatur Hand in Hand: Kulturwissenschaft als verflochtenes Wissensfeld
Im Folgenden finden Sie einen Ausschnitt aus Aleida Assmanns neu bearbeiteter und erweiterter 5. Auflage des Einführungsbandes. In dem Kapitel „Künstliche und symbolische Körper“ geht es um die Frage, wie Körperlichkeit auch über den Menschen hinaus verstanden werden kann. Dazu werden literarische Werke aus unterschiedlichen Epochen mit kulturwissenschaftlicher Theorie, medienwissenschaftlichen Erkenntnissen und technologischen Innovationen verknüpft. Lesen Sie selbst, um sich einen Eindruck des hier dargebotenen kulturwissenschaftlichen Facettenreichtums zu machen:
3.3.2 Künstliche und symbolische Körper
Das Wort Körper wird nicht nur auf individuelle Organismen angewandt, sondern auch auf ganze Kollektive und anderweitig unsinnliche Konzepte, die durch das Verleihen eines symbolischen ‚Körpers‘ in den Rang der Anschaulichkeit erhoben werden. Ein Beispiel dafür ist die Schrift des Thomas Hobbes über den Staat, die den Titel Leviathan (1651) trägt. Das Titelbild dieses Buches zeigt aber nicht ein mythisches Meeresungeheuer, sondern einen riesigen Menschen, der sich über eine Landschaft mit Bergen und Ortschaften erhebt. Dieser Mensch, ein bis zur Taille sichtbarer Mann, trägt die Insignien des Königtums mit Krone, Schwert und Szepter. Schaut man sich sein Wams etwas näher an, so entdeckt man, dass der Körper dieses Riesen wiederum aus unzähligen winzigen Körpern von Menschen besteht, in Reih und Glied aufgestellt und ihm zugewandt. Auf diese Darstellung nimmt Hobbes in seiner Einleitung Bezug und erläutert, dass es sich hier um einen künstlichen Menschen handelt, der wie die Maschine eines Automaten technisch zusammengesetzt ist. „For by Art is created that great LEVIATHAN called COMMON-WEALTH, or STATE (in latine CIVITAS) which is but an Artificiall Man; though of greater stature and strength than the Naturall, for whose protection and defence it was intended.“ Hobbes fährt mit seiner Beschreibung des künstlichen Menschen fort, indem er jedem menschlichen Körperteil eine politische Funktion zuordnet. Der menschliche Körper ist hier jedoch mehr als nur eine Versinnlichung von Unsinnlichem oder eine Gedächtnisstütze für die Organisation des Staates; mit der Betonung der Künstlichkeit dieses Körpers setzt sich der Mensch selbst in die Position des göttlichen Schöpfers und zeigt, dass er im Reich der Künstlichkeit so schalten und walten kann wie Gott im Reich der Natur.
Hobbes’ Megakörper, der aus einzelnen Körpern besteht, ist eine Hypostase oder Allegorie des Staats. Vor Hobbes gab es einen anderen symbolischen Körper, der nicht den Staat, sondern das Königtum repräsentierte. Nach spätmittelalterlicher Auffassung besitzt der König zwei Körper, einen sterblichen Körper und einen unsterblichen Amtskörper. Mit dem einen ist er ein Mensch wie jeder andere, mit dem anderen ragt er weit über die Menschen hinaus. Diese Bedeutung kommt ihm über sein Amt zu, das ein von Gott gegebenes und unvergängliches ist. Die Doktrin von den zwei Körpern des Königs sichert die Kontinuität des Amts über die Sterblichkeit seiner Inhaber hinweg. Auf diese Weise sollen Zeit und Kontingenz ausgeschaltet und zuverlässige Kontinuität und Dauer gesichert werden. Der Tod des Königs, der durch die Gefahr von Chaos und Umsturz immer auch eine Erschütterung der Weltordnung bedeutet, wird überwunden durch den zweiten unsterblichen Körper des Königs.
[…]
| Nachgefragt bei: Prof. Dr. Aleida Assmann | 24.01.2017 |
| Assmann: „In den Kulturwissenschaften geht es um die Fähigkeit, flexibel, neugierig und kreativ auf Wandel zu reagieren“ | |
 |
Im Januar erscheint bereits die 4. Auflage der „Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen“. Die Autorin, Professorin Aleida Assmann, erläutert im Interview mit der ESV-Redaktion, welche Rolle Hamlet in dem Buch spielt und was es mit den Bezeichnungen der sieben Kapitel auf sich hat. mehr … |
Um von Mittelalter und früher Neuzeit in die Moderne und Gegenwart zu springen: Im Zeitalter seiner bio-technischen Programmierbarkeit ist die Natur des Menschen heute keine unhintergehbare Größe mehr. Der Mensch ist aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und technischer Verfahren befähigt, in seine eigene Evolution einzugreifen und seine genetische Konstitution samt der seiner Nachkommen zu verändern. Die Formel vom Körper-Sein und Körper-Haben erhält hier eine neue Bedeutung: Der Mensch, der Körper ist, modifiziert den Körper, den er hat. 180 Jahre bevor diese Selbstmanipulation in den Horizont des Möglichen trat, hat Mary Shelley das Problem in einem bis heute wirkungsvoll gebliebenen Schauerroman vorweggenommen. In ihrem Roman Frankenstein wird der Protagonist zu einem modernen Prometheus, der als Wissenschaftler die Grundbausteine des Lebens manipuliert und damit die göttliche Macht des Leben-Spendens zusammen mit der weiblichen Kraft des Zur-Welt-Bringens usurpiert. Da der Mensch aber nicht ein für alle mal mit seiner Herstellung geformt wird, sondern durch Erziehung beständig weiter gebildet werden muss, mutiert das sich selbst überlassene und von aller Welt verlassene Produkt des Experiments zum Monstrum. Shelley stellt den Typus des Forschers dar, der die Kontrolle über sein Forschungsobjekt verliert und vom souverän Agierenden zum verzweifelt Getriebenen wird.
Im Zuge des Klonens sind die Grenzen dessen, was bislang als ‚künstlich‘ und was als ‚natürlich‘ galt, längst überschritten. In Forschungslabors gibt es derzeit immer mehr geklonte Tiere, die künstlich entstanden sind, sich aber selber (und somit natürlich) fortpflanzen. Ähnlich problematisch gestalten sich Urteile über den menschlichen Organismus, in dem immer mehr Funktionen von digitalen Chips übernommen werden. Hier zeichnen sich die Umrisse eines ‚post-humanen Körpers‘ ab, eine Vorstellung, zu der Donna Haraway in einem wichtigen Beitrag Stellung genommen hat. Diese von Mary Shelley aufgeworfenen Fragen werden so in Cyborgs an unsere Gegenwart gerichtet. Hintergrund dieser fiktiven Technologie ist das Phantasma der Unsterblichkeit eines technisch implementierten Körpers. Nach dem Ende der christlichen Heilsvisionen sind die ungestillten Heilserwartungen auf Medizin und Technik übertragen worden. Generell hat die neue Kulturtechnik des elektronischen Schreibens neue anthropologische Bedingungen und Veränderungen geschaffen. Die tendenzielle Trennung von Körper und Schrift, die bereits die Grundlage der Alphabetschrift bildet, wurde durch die neue Technologie noch gesteigert. Der materielle dreidimensionale Körper des users bleibt bei Ausflügen in chat rooms und Cyberwelten außen vor und an seiner Stelle dringt ein so genannter ‚Avatar‘, d. h. ein virtueller Ersatzkörper, in die digitale Welt ein. Das führt, anthropologisch gesehen, zu einer neuen Spaltung, nun nicht mehr zwischen Körper und Geist, sondern zwischen einem organischen und einem gerechneten virtuellen Körper.
Haben wir Ihr Interesse an dem Einführungsband geweckt? Hier können Sie das Buch bequem online erwerben.
| Zur Autorin |
| Aleida Assmann studierte Anglistik und Ägyptologie. Sie hat an Ausgrabungen in Oberägypten mitgearbeitet und zusammen mit Jan Assmann 1979 einen kulturwissenschaftlichen Arbeitskreis gegründet, aus dem zahlreiche interdisziplinäre Publikationen hervorgegangen sind. Von 1993-2014 lehrte sie Anglistik und Allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz. Sie unterrichtete als Gastprofessorin u.a. an den Universitäten Princeton, Yale und Chicago. 2008 erhielt sie einen Ehrendoktor der theologischen Fakultät der Universität Oslo; 2014 wurde sie mit dem Heineken Preis für Geschichte der Königlichen Akademie der Wissenschaften der Niederlande ausgezeichnet. Mit den Mitteln des Max Planck-Forschungspreises leitete sie von 2009-2015 die Forschungsgruppe ‘Geschichte und Gedächtnis’. 2018 erhielt sie zusammen mit ihrem Mann Jan Assmann den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Ausgewählte Publikationen: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses (3. Aufl. 2006); Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur (2013); Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Niedergang des Zeitregimes der Moderne (2013); Im Dickicht der Zeichen (2015); Formen des Vergessens (2016). |
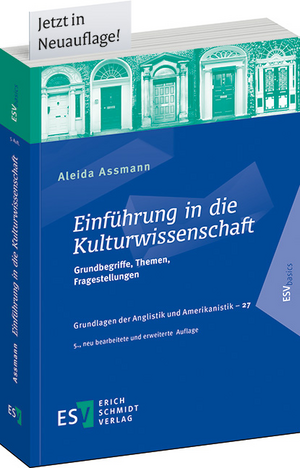 |
Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen Von Aleida Assmann Das Buch gliedert sich in die Kapitel ,Zeichen‘, ,Medien‘, ,Körper‘, ,Zeit‘, ,Raum‘, ,Gedächtnis‘, ,Identität‘. Es möchte möglichst voraussetzungslose Einstiege in komplexere theoretische und historische Zusammenhänge eröffnen und dabei auch das Interesse an Literatur verschiedener Gattungen und Epochen wecken. Der Band versteht sich nicht nur als Einführung, sondern auch als ein studienbegleitendes Hilfsmittel für eigenständige Erkundungen des Zusammenhangs von Textlektüre und wichtigen aktuellen Grundfragen der Kultur. |
Programmbereich: Anglistik und Amerikanistik
