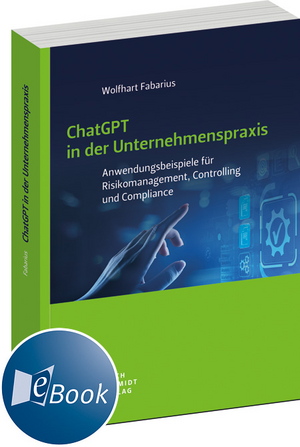Weil sich das vom Bewerber vorgelegte Essay qualitativ deutlich von denen der anderen Bewerber abhob, vermutete das VG München den unerlaubten Einsatz von KI (Foto: Bussarin / stock.adobe.com)
Verbotene Hilfe durch KI?
VG München zum Einsatz von KI-Tool bei Eignungstest für Masterstudium
ESV-Redaktion Recht
06.03.2024
Der Einsatz von KI dringt in viele Bereiche vor. Allerdings kann es auch Grenzen geben – und zwar vor allem da, wo menschliche schöpferische Leistungen gefragt sind, etwa bei Eignungstests. So hatte die TU München dem Bewerber für einen Masterstudiengang die Zulassung versagt, weil dieser nach ihrer Vermutung beim Erstellen eines Essays unerlaubt ein KI-Tool eingesetzt hatte. Über die Rechtmäßigkeit der Versagung hat nun das VG München in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss entschieden.
In dem Streitfall verlangte der Antragsteller im Eilverfahren eine vorläufige Zulassung zu einem Masterstudiengang an der TU München. Beworben hatte er sich zunächst erfolglos zum Wintersemester 2022/23. Anschließend bewarb er sich erneut zum Wintersemester 2023/24. Hierfür legte er neben anderen Unterlagen ein sogenanntes Essay vor.
Auch diese Bewerbung blieb ohne Erfolg. Die TU München schloss den Antragsteller mit Bescheid vom 01.08.2023 vom Bewerbungsverfahren aus. Der Grund: Der Bewerber habe versucht, den Bewerbungsprozess durch Täuschung zu beeinflussen, indem er für das Erstellen des Essays eine KI einsetzte.
Antragsteller: Keine ordnungsgemäße Anhörung zum Täuschungsvorwurf
Im September 2023 klagte der Antragsteller dann vor dem VG München – unter dem Aktenzeichen: M 3 K 23.4370 auf Verflichtung zur Zulassung zum begehrten Studium. Gleichzeitig beantragte er im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes, ihn vorläufig im Wintersemester 2023/24 im ersten Fachsemester zum Vollzeitstudium zuzulassen.
Dabei rügte er unter anderem, dass er in seinem Essay persönlich sämtliche Ausführungen mit Quellen belegt habe, wozu KI gar nicht in der Lage wäre. Zudem habe er erstmals im Rahmen seiner Akteneinsicht von dem Plagiatsvorwurf erfahren. Damit wäre eine ordnungsgemäße Anhörung zum Täuschungsvorwurf im Zulassungsverfahren unterblieben.
Antragsgegner: Voraussetzungen für Anscheinsbeweis in Bezug auf die Täuschung liegen vor
Demgegenüber beantragte der Antragsgegner die Ablehnung des Eilantrags. Seine Begründung: Das Essay entspricht entgegen der Versicherung des Antragstellers nicht den Regeln wissenschaftlicher Sorgfalt. Demnach wurden 45 % des Textes mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von künstlicher Intelligenz verfasst. Darüber hinaus ließ die TU die KI-Software ChatGPT mit Anweisungen für einen entsprechendes Essay einen Text erstellen. Dieser zeigte im Vergleich mit dem Text des Bewerbers signifikante Ähnlichkeiten, was von der TU eingesetzte Prüfer auch bestätigt hätten. Damit wäre für die Annahme einer Täuschung der Anscheinsbeweis eröffnet, so der Antragsgegner.
| Der kostenlose Newsletter Recht – Hier können Sie sich anmelden! |
Redaktionelle Meldungen zu neuen Entscheidungen und Rechtsentwicklungen, Interviews und Literaturtipps.
|
VG München: Ausschluss von Bewerbungsverfahren aller Voraussicht nach rechtmäßig
Der Eilantrag hatte keinen Erfolg. Das VG schloss sich im Wesentlichen der Auffassung des Antragsgegners an und lehnte den Antrag ab. Demnach hatte der Antragsteller einen Anordnungsanspruch nicht glaubhaft dargelegt und der Ausschluss vom Bewerbungsverfahren war voraussichtlich rechtmäßig. Die weiteren wesentlichen Erwägungen des VG:
- Fehlende Anhörung unerheblich: Auch mit seinem Einwand, nach dem er nicht ordnungsgemäß zum Täuschungsversuch angehört wurde, drang der Antragsteller nicht durch. In der Hauptsache begehrt er nämlich im Rahmen einer Verpflichtungsklage den Zugang zum Masterstudium. Hierfür ist allein entscheidend, ob er einen solchen Anspruch hat. Hierüber muss das Gericht ohne Rücksicht auf Mängel des Verwaltungsverfahrens entscheiden. Unabhängig davon wäre ein Anhörungsmangel auch heilbar gewesen.
- Beweislast für Regelverletzung zwar bei TU: Zwar liegt die Beweislast für die Verletzung der von ihr aufgestellten Regeln grundsätzlich bei der TU, so das VG.
- Aber – Anscheinsbeweis möglich: Allerdings, so das Gericht weiter, können sowohl die objektiven als auch die subjektiven Voraussetzungen einer Täuschung über die Regeln des Anscheinsbeweises erbracht werden. Dabei muss die nachzuweisende Tatsache auf einem typischen Sachverhalt basieren, der anhand von allgemeinem Erfahrungswissen zu der Annahme berechtigt, dass die betreffende Tatsache gegeben ist. Darüber hinaus dürfen keine Anhaltspunkte vorliegen, die auf ein atypisches Geschehen schließen lassen.
- Zum Inhalt des Essays: Insoweit meint das Gericht, dass sich das Essay sowohl von denen der anderen Bewerber als auch von dem Text, den der Antragsteller abgegeben hatte, qualtitativ deutlich abhebt. Gleichzeitig zeigt der Text typische Merkmale, die für eine Erstellung mithilfe von künstlicher Intelligenz sprechen. Diese Auffälligkeiten, die mit der besonderen Qualität des Textes korrespondieren, sind nach den Erfahrungen der eingesetzen Prüfer starke Anzeichen der Stärken von KI, die auch darin liegen, Inhalte äußerst kompakt darzustellen.
- Einwand der persönlichen Quellenanbringung unbeachtlich: Auch mit seinem Einwand, nach dem er sämtliche Ausführungen persönlich mit Quellen belegt habe, was KI nicht leisten könne, drang der Antragsteller nicht durch. Nach Auffassung des Gerichts ist nämlich nicht ersichtlich, dass der wesentliche Teil der Essayerstellung in der Recherche liegt und dass das Formulieren demgegenüber unbedeutend war. Der Vorwurf, dass das Essay mit unerlaubten KI-Tools erstellt wurde, setzt nicht voraus, dass auch das Einfügen von Quellen unerlaubt erfolgt.
- Keine weiteren Anhaltspunkte für die hohe Qualität des Essays: Schließlich hatte der Antragsteller keine Erklärung dafür vorgetragen, warum sich sein Essay qualitativ so deutlich von seinem ersten Essay unterscheidet. Auch weitere Anhaltpunkte für einen atypischen Lebenssachverhalt sah das VG München nicht.
|
|
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz revolutioniert die Arbeitswelt und mit ChatGPT steht hierbei ein besonders vielseitig nutzbares Anwendungstool zur Verfügung. Wie Sie als Governance-Verantwortlicher den Chatbot sinnvoll einsetzen können, zeigen die Praxisbeispiele in diesem Buch mit thematischen Schwerpunkten wie Nachhaltigkeit, Cybersicherheit, Datenschutz und Überwachung von Lieferketten.
Neben den Stärken von ChatGPT werden auch die Risiken der KI aufgezeigt, die vor allem aufgrund von fehlerhaften und subjektiv gefärbten Antworten des Chatbots bestehen. Es wird verdeutlicht, dass sich ChatGPT zwar als Arbeitshilfe eignet. Die Verantwortung bei der Nutzung von KI-generierten Informationen bleibt jedoch bei den anwendenden Personen.
Eine erstmalige Zusammenstellung praktischer KI-Anwendungsbeispiele für Risikomanagement, Controlling und Compliance – leicht verständlich sowohl für Governance-Profis als auch Nutzerinnen und Nutzer ohne große Vorkenntnisse.
Hören Sie hier den Interview-Podcast Der Einsatz von ChatGPT in Unternehmen – Bernd Preiß mit seinem Gast: Wolfhart Fabarius.
Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert die Arbeitswelt – und vor allem mit ChatGPT steht ein besonderes Anwendungstool bereit, das vielseitig einsetzbar ist. Wie Governance-Verantwortliche den Chatbot sinnvoll einsetzen können, erläutert Wolfhart Fabarius anhand von Praxisbeispielen in dem Interview-Podcast. In dem Podcast geht Fabarius – begleitend zu seinem neuen Buch – vor allem auf KI-Anwendungsbeispiele für Risikomanagement, Controlling und Compliance ein. Insoweit hat er den Chatbot unter anderem Risikomanagement-Konzepte aufsetzen lassen. Eine weitere Frage lautet etwa: Kann ChatGPT Finanzberichte selbst erstellen?
|
| Verlagsprogramm |
Weitere Nachrichten aus dem Bereich Recht
|
(ESV/bp)
Programmbereich: Wirtschaftsrecht