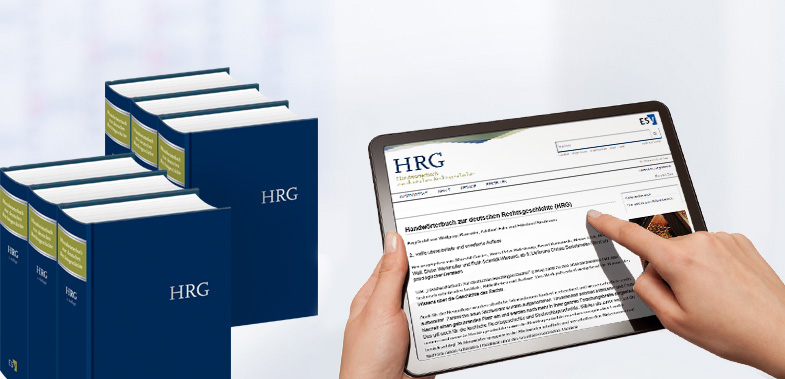
Von Reichsgesetzgebung bis Reichsvikariat
---------------------------------------------------------------
Reichsverweser
„R.“ ist ein Gattungsbegriff (mhd. verweser = Vertreter) für den Inhaber der monarchischen Gewalt oder Teilen davon bei Fehlen oder bei Regierungsunfähigkeit des Monarchen. Die Rechtsstellung des R. bestimmt der Bestellungsakt. Er kann vom Monarchen eingesetzter Stellvertreter sein (Äbtissin Mathilde von Quedlinburg für ihren Neffen Ks. Otto III. in Deutschland während dessen Italienzug 995). Häufig ist die Verbindung mit der Vormundschaft des minderjährigen Monarchen (Ebf. Engelbert von Köln für Kg. Heinrich 1220 durch den in Italien weilenden Ks. Friedrich II.). Monarchenstellung in mehreren Ländern konnte zu unterschiedlichen Situationen führen. Ladislaus Postumus, der Sohn Kg. Albrechts II., stand zwar unter der Vormundschaft Ks. Friedrichs III., doch wählten Ungarn 1446 mit Johann Hunyádi und 1452 Böhmen mit Georg v. Podiebrad je eigene R. R. überwiegend zu eigenem Recht schuf auf gesetzlicher Grundlage das deutsche Reichsvikariat und ähnlich den meist von den Ständen gewählten Paladin Ungarns, zumal dessen habsburgische Könige ab 1526 im Ausland (Wien, Prag) residierten.
Im Verfassungsstaat sieht allenfalls die Verfassung einen R. vor. Die 1848 im Deutschen Bund etablierte „Vorläufige Zentralgewalt“ (Gesetz vom 28.06.1848) bestand neben Reichsministerien aus einem Staatsoberhaupt anstelle des noch ungewissen Monarchen mit dem Titel „R.“. Die Wahl fiel auf ein Mitglied des Kaiserhauses Habsburg, den liberalen Erzhzg. Johann. Er übte das Amt vom 05.07.1848 bis zum 01.01.1850 aus. Als Ungarn nach einer republikanischen Phase (ab 1918) und einer räterepublikanischen (ab 1919) 1920 zur Monarchie zurückkehrte, blieb die Position des Königs unbesetzt. „Freie Königswähler“ standen gegen die „Legitimisten“, die für eine Restauration der Habsburger eintraten, was ohnedies die Siegermächte untersagten. Als Staatsoberhaupt fungierte daher ein „R.“ (kormányzo), zu dem der letzte Oberbefehlshaber der österreichischungarischen Kriegsmarine Admiral Nikolaus (Miklós) Horthy gewählt wurde; im Oktober 1944 trat er zurück und erhielt keinen Nachfolger.
Während der R. einen an sich vorgesehenen Monarchen ersetzte, traten andere Einrichtungen neben diesen und beschränkten ihn auf Rang und Würde. Dies geschah bei einer Regentschaft wie die des Prinzregenten Luitpold v. Bayern für den geisteskranken Kg. Otto 1872 bis 1912 oder durch ein Kollegialorgan wie der Geheimen Staatskonferenz für den kranken Ks. Ferdinand v. Österreich 1835 bis 1848. [...].
| Das könnte Sie auch interessieren: Ein Interview mit Prof. Dr. Wolfgang Sellert zur Erschließung der Akten des Kaiserlichen Reichshofrats | 04.05.2022 |
| „Geplant ist die Erschließung der gesamten Serie der ‚Antiqua‘ des RHR bis spätestens 2025“ | |
 |
Drei Regalkilometer mit Zehntausenden von Akten und Amtsbüchern: diese Quellen zur Tätigkeit des Kaiserlichen Reichshofrats (RHR), die im Österreichischen Staatsarchiv, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, lagern, werden seit 2007 in einem einzigartigen deutsch-österreichischen Kooperationsprojekt erschlossen. Insgesamt sind seit 2009 bereits 11 Bände der Akten des RHR erschienen; soeben wurde der 6. Band der Serie „Antiqua“ im Druck vorgelegt. mehr … |
Reichsvikariat
Das Rechtsinstitut des R. ordnet sich rechtsdogmatisch in das Recht der Stellvertretung ein. Es geht um Stellvertreter, Mit- und Ersatzherrscher (vgl. den treffenden Titel der grundlegenden Monographie von Heckmann, 2002, mit tiefgründigen komparatist. Ausführungen zu Deutschland, England u. Frankreich). Die relativ späte dt. Bezeichnung reichs-vicariat (nach DRW erstmals 1657) kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Institution sehr alt ist. Sie geht auf die ant. röm. Provinzialverwaltung, für die bestimmte Amtsträger mit unterschiedlich ausgestalteter Statthalterfunktion eingesetzt waren, zurück (praetor, praefectus, procurator, proconsul, proquaestor u.a.). Das Wort vicarius bezeichnete im röm. Recht jeden Stellvertreter (Gutsfeld, 181; Kaser/Knütel/Lohsse, 129). Im spätröm. Reich steht vicarius häufig für den Vertreter des praefectus praetorio in einer Prov. sowie für den Statthalter einer Diözese (Gutsfeld, 181). Der praefectus des röm. Rechts war ein von einem Magistrat (später vom Ks.) bestellter Funktionsträger, der für eine bestimmte Zeit als Stellvertreter eingesetzt wurde, um eine per mandatum übertragene Aufgabe (Inhalt der Vertretungsbefugnis) zu erfüllen (Eck, Praefectus, 241). Auch dauerhafte Vertretungsverhältnisse sind so entstanden. Eine zweite Rechtsfigur des röm. Rechts, die dem praefectus sehr verwandt ist, ist der procurator. Ihm wurden die Verwaltung großer Vermögensmassen, aber auch die Verwaltung von Güter-, Steuer und Staatsangelegenheiten anvertraut. Ferner wurde er zur Rechtsprechung mit entsprechenden Vertretungsbefugnissen ausgestattet (Eck, Procurator, 366 f.; Kaser/Knütel/Lohsse, 70, 337). Folglich lassen sich dazu, zunächst auf der normativen Ebene, zahlreiche röm.-rechtl. und kan. Quellen ausmachen (z.B. D. 3, 5, 5, 3 [Ulp.]; D. 14, 3, 20 [Scaev.]; X 1.28 [De officio vicarii]; X 1.38 [De procuratoribus]). Auch die byz. Verfassungsgeschichte weist Vorläufer des R. auf. Analoges gilt für die mehr oder weniger röm.-rechtl. beeinflussten sog. Germ. Volksrechte, die ebenfalls z.B. Bezeichnung und Amt des vicarius kennen (L. Vis. – MGH LL nat. Germ. 1, 75, 166, 203 u.ö.; L. Burg. – MGH LL nat. Germ. 2/1, 48, 129, 163 u.ö.). Nimmt man die zahlreichen urkundlichen Belege hinzu, gelangt man für das MA zu einer beträchtlichen Begriffsvielfalt: capitaneus (Hauptmann), locum tenens, procurator, Reichsverweser (Heckmann, 2002, 105, 361), vicarius (in der staufischen → Kanzlei erstmals 1161 nachweisbar – Heckmann, 2002, 36), praefectus, Vormund, Fürseher, servitor et officiatus imperii (Favreau-Lilie, 62), vicarii regie et imperialis maiestatis (Favreau-Lilie, 76), legatus (Heckmann, 2002, 334) u.v.a. Der Reichsvikar war nicht nur Vertreter, sondern auch Substitut, d.h. Ersatz, für den Ks. Rechtl. konnte er für den Ks. als Stellvertreter, aber auch an der Stelle des Ks. als dessen Substitut und somit während eines Interregnums im Namen des Reiches (vice et nomine sacri imperii) handeln – und nicht des Ks., da jener bei Thronvakanz nicht vorhanden war. [...]
---------------------------------------------------------------
Falls Sie neugierig geworden sind: Die aktuelle 31. Lieferung und alle 30 vorher erschienenen Lieferungen können Sie hier bei uns bestellen.
Das Handwörterbuch liegt zudem auch als Datenbank vor, sodass Sie auch bequem online recherchieren und lesen können. Fragen Sie Ihre Bibliothek nach einer Campus-Lizenz!
Programmbereich: Rechtsgeschichte

