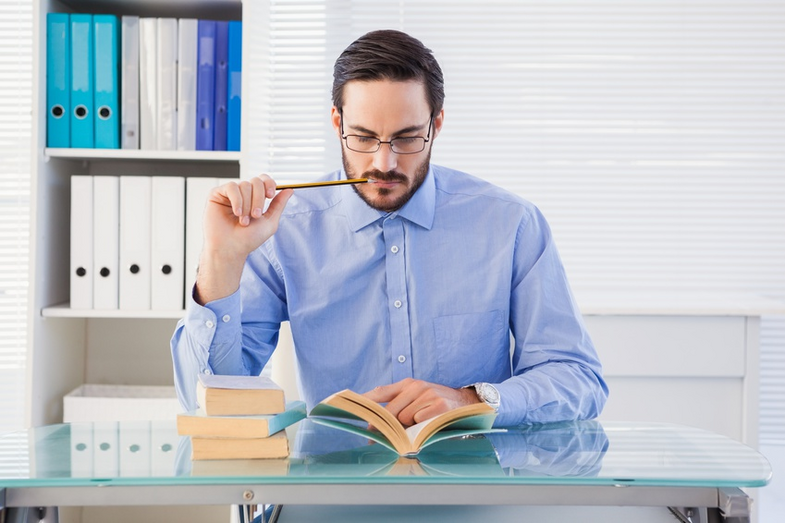
Wer ist „per se“ wie weit für den Arbeitsschutz verantwortlich?
Die Antwort lautet: „Als ‚Vorgesetzter‘ (Gruppenleiter, Meister, Abteilungsleiter etc.) ist man nicht automatisch für den Arbeitsschutz im Sinn der Regelungen des ArbSchG verantwortlich. Es bedarf entweder der Arbeitgeberfunktion oder der in § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 ArbSchG genannten Funktionen. Sollte diese Funktion bei einem ‚Vorgesetzten‘ nicht gegeben sein, bedarf es zur Rechtswirksamkeit der Delegation durch den Arbeitgeber einer gesonderten Übertragung nach § 13 Abs. 2 oder vergleichbarer Formulierungen im Arbeitsvertrag.“
Das ist sehr missverständlich, denn diese Antwort berücksichtigt nur die „Regelungen des ArbSchG“, stellt das immerhin aber klar. Diese Einschränkung liest indes kein Mensch – ich habe das selbst in vielleicht 50 Veranstaltungen getestet. Niemand hat die Antwort so verstanden, dass sie sich nur auf ArbSchG bezieht, sondern alle haben geschlussfolgert, das gilt immer: Vorgesetzte seien also nicht – „per se“ – verantwortlich für den Arbeitsschutz, sondern erst, wenn sie schriftlich gemäß § 13 Abs. 2 ArbSchG beauftragt werden.
Der KOMNET-Dialog verschweigt, dass wir eine Gesamtrechtsordnung haben: „Sobald jemand einen Paragraphen eines Gesetzbuches anwendet, so wendet er das ganze Gesetzbuch an“ – so hat es Rudolf Stammler gesagt. Noch schöner ist ein Satz des amerikanischen Juristen Oliver Wendell Holmes Jr.: „Als Juristen haben Sie die Aufgabe, das Verhältnis Ihres speziellen Falles zum ganzen Universum zu sehen.“
Der KOMNET-Dialog unterschlägt die neben der verwaltungsrechtlichen/öffentlich-rechtlichen Verantwortung der Beschäftigten gegenüber dem Staat bestehende zivil- und strafrechtliche Verantwortung nach den allgemeinen Rechtsvorschriften nach Arbeitsunfällen – jedenfalls nach der Zahl der Gerichtsurteile sind diese Schadensersatzansprüche oder Strafsanktionen der entscheidende Bereich des Rechts-Universums. Dort gilt die einfache Regel: Jeder Mitarbeiter (jeder Mensch) ist automatisch und ohne schriftliche Pflichtenübertragung für die übernommenen (Leitungs-)Aufgaben im Rahmen seiner Befugnisse verantwortlich (ausführlich Wilrich, Sicherheitsverantwortung: Arbeitsschutzpflichten, Betriebsorganisation und Führungskräftehaftung – mit 25 erläuterten Gerichtsurteilen, 2016). Die DGUV Information 211-006 „Sicherheit und Gesundheitsschutz durch Koordinieren“ drückt es so aus: „Vorgesetzte ohne Verantwortung gibt es nicht. Wer es ablehnt, Verantwortung zu tragen, kann nicht Vorgesetzter sein.“ Das muss in einer ganzheitlichen Antwort auch betont werden, um dem häufig zu beobachtenden Missverständnis zu begegnen, dass doch die „Fachkraft für Arbeitssicherheit für den Arbeitsschutz verantwortlich ist – und nicht ich“.
Aber auch im Hinblick auf das Öffentliche Recht/Verwaltungsrecht ist die Antwort im KOMNET-Dialog 4428 lückenhaft. Wenn es heißt, dass „es entweder der Arbeitgeberfunktion oder der in § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 ArbSchG genannten Funktionen bedarf“, ist das wieder zu eng und zu wenig: Vergessen werden „sonstige“ nach einer auf Grund des ArbSchG erlassenen Rechtsverordnung oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift „verpflichtete Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse“ gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 5 ArbSchG. Und in den Arbeitsschutzverordnungen und UVVs werden zahlreiche Personen mit Arbeitsschutzaufgaben belegt.
So leitete das Landgericht Bielefeld im Urteil vom 13. März 2015 (Az. 1 O 82/13) die Arbeitsschutzverantwortung eines beklagten Dachdeckers aus dieser leicht übersehenen Rechtsvorschrift ab: Zwar „hat das Bauunternehmen den Beklagten nicht schriftlich damit beauftragt hat, den ihr obliegenden Arbeitsschutz in eigener Verantwortung wahrzunehmen (§ 13 Abs. 2 ArbSchG). Die Verantwortlichkeit trifft nach § 13 Abs. 1 Nr. 5 ArbSchG auch sonstige nach einer Unfallverhütungsvorschrift verpflichtete Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse. Gemäß § 4 Abs. 2 BGV C 22 müssen Bauarbeiten von weisungsbefugten Personen beaufsichtigt werden, die die arbeitssichere Durchführung der Bauarbeiten überwachen müssen. Diese Funktion kam vorliegend dem Beklagten zu.“ Im Urteil 2. Instanz vom 18. Dezember 2015 (Az. 9 U 75/15) stellte das OLG Hamm zum Dachdecker eher wieder auf die automatisch bestehende zivilrechtliche Verantwortung ab und sagte beiläufig nur noch, dass „nicht mehr streitig ist, dass er als einziger Arbeitnehmer des Bauunternehmens und als einziger kundiger Facharbeiter auf dem Dach verantwortlich für die Tätigkeit der Arbeitnehmer und deren Arbeitssicherheit war“ und damit „für das Wohl und Wehe der ihm unterstellten Arbeiter verantwortlich war.“
Fazit
Insgesamt meine ich: Es ist problematisch, so berechtigte, aber auch schwierige Fragen wie die nach der „per se“ bestehenden Arbeitsschutz- und Sicherheitsverantwortung nur mit dem ArbSchG zu beantworten und die Ganzheitlichkeit unseres komplexen Rechtsystems nicht mit zu berücksichtigen – zumal sich der Arbeitsschutz leider auch und gerade in zivilrechtlichen Schadensersatzprozessen und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren realisiert.
| Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Wilrich ist tätig rund um die Themen Produktsicherheit, Produkthaftung und Arbeitsschutz einschließlich Betriebsorganisation, Führungskräftehaftung, Vertragsgestaltung und Strafverteidigung. Er ist an der Hochschule München zuständig für Wirtschafts-, Arbeits-, Technik- und Unternehmensorganisationsrecht und Autor von Fachbüchern: Sicherheitsverantwortung (Erich Schmidt Verlag), Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Rechtliche Bedeutung technischer Normen. |
Das könnte Sie auch interessieren:
Sicherheitsverantwortung rechtskonform delegieren
Wie Führungskräfte Organisationsverschulden vermeiden
Betriebliche Prävention und sicher ist sicher
(gegen Vorlage des VDSI-Ausweises)

Inhalte:
- Der Ausgangspunkt: Gelebte Organisation
- Wer ist automatisch wie weit für was zuständig und verantwortlich – und warum?
- Die 10 Gebote der (rechtssicheren) Pflichtenübertragung:
- 1. Wer kann delegieren?
Zuständigkeiten und Befugnisse der Führungskräfte - 2. An wen delegieren?
Zuverlässigkeit und Fachkunde der Mitarbeiter - 3. Womit soll ich delegieren?
Instrumente und Mittel - 4. Wie soll ich delegieren?
Nachweisdokumentation - 5. Was soll ich delegieren?
Pflichtenumfang - 6. Welche Worte soll ich nutzen?
Klarheit - 7. Wie exakt muss man sein?
Detailtiefe / Bestimmtheit - 8. Wie weit muss man instruieren?
Ein- und Unterweisung - 9. Womit muss man ausrüsten/ausstatten?
Ressourcen - 10. Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche
Koordination - Abschluss: Überblick zu den Aufsichtspflichten als Rechtsfolge
- Wie groß ist das Haftungsrisiko wirklich?
Teilnehmer/innenstimmen zu dieser Veranstaltung:
Ihr Referent:
Programmbereich: Arbeitsschutz

