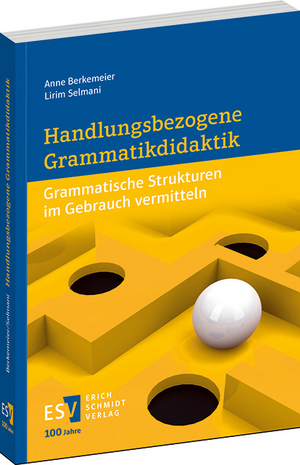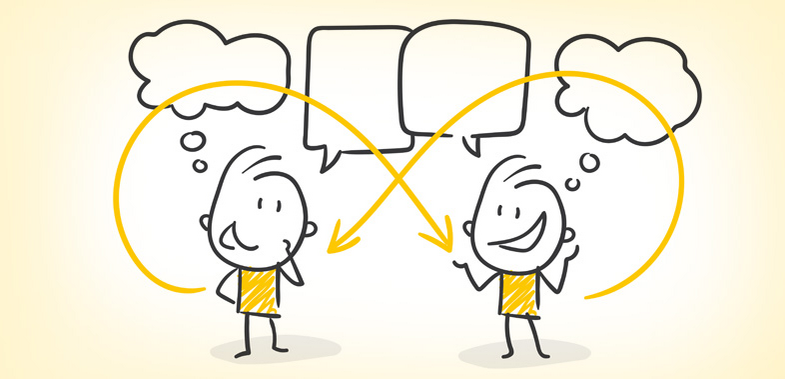
Zeitgemäße Alternativen zum bisherigen Grammatikunterricht
Der vorliegende Auszug ermöglicht Ihnen erste Einblicke in die funktional-pragmatischen Überlegungen zu einem moderneren und nachhaltigeren Grammatikunterricht. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
-------------------------------------------------------------------------
Formen in kommunikativer Funktion begreifen: Grammatikbeschreibung für verständliches Formulieren und für erfolgreiches Verstehen nutzen
Warum sollte man grammatische Formen vom Handlungskontext aus betrachten? Menschen kommunizieren miteinander, um sich zu verständigen. Dabei verfolgen sie kommunikative Zwecke (Handlungszwecke). Sie verständigen sich z. B., um sich gegenseitig zu informieren, zu unterhalten oder um Zuhörende (H) bzw. Leser:innen (L) anzuleiten oder zu überzeugen. Die Verständigung kann erfolgreich sein oder misslingen und muss dann repariert werden. […]Für die Lösung kommunikativer Probleme eignen sich rein formale Grammatiktheorien wenig. Stattdessen braucht man eine Grammatiktheorie, die kommunikatives Verständigungshandeln ausgehend vom jeweiligen Handlungskontext und -zweck beschreibt wie die funktional-pragmatische (Ehlich/Rehbein 1986, Rehnebin/Kameyama 2004), denn aus dem zweckgerichteten sprachlichen Handeln ergibt sich, welche Formen kommunikativ funktional oder dysfunktional wirken. […]
Es erscheint uns daher naheliegend, auch im Unterricht vom Handlungskontext auszugehen, um sprachliche Formen in (Dys-)Funktion zu behandeln. Bestenfalls werden (dys-)funktional verwendete Einheiten im eigenen sprachlichen Handeln erfahrbar und für die Entwicklung der eigenen kommunikativen Handlungskompetenz nutzbar gemacht. Verständlichkeit und Verstehen können nur im Handlungszusammenhang thematisiert werden.
Das vorliegende Konzept bietet eine teilerprobte Auswahl an Handlungskontexten an und zeigt, wie die Unterstützung des Sprachausbaus systematisiert werden kann. […]
Die Stärke des situationsorientierten Ansatzes [Boettcher/Sitta 1978) besteht darin, dass er sich auf zu bewältigende (quasi-)authentische Handlungssituationen orientiert. Er konnte sich in der Schule u.a. deshalb nicht durchsetzen, weil traditionelle schulgrammatische Beschreibungskategorien nicht ausreichen, um Sprache in Handlungssituationen angemessen zu beschreiben (vgl. Hoffmann 1993). Mit funktional-pragmatischen Kategorien kann dies inzwischen gelingen, weil dort nicht nur die Formen, sondern auch ihre Funktionen berücksichtigt sind, nicht nur isolierte, eigens für den Grammatikunterricht konstruierte Beispiele, sondern auch authentische Texte und Diskurse in den Blick genommen werden können und auch mündliche Strukturen analysier- und benennbar sind. So ist es möglich, Formulierungen in interaktiven Kontexten zu reflektieren und gezielt über sinnvolle Alternativen zu entscheiden.
Linguistisches Hintergrundwissen: Formen – Funktionen – Handlungsformen
Sprachliches Handeln funktional-pragmatisch gedacht
[…] Traditionell ist der Grammatikunterricht seit jeher auf die Bestimmung von Wortarten, Satzgliedern und Satzarten orientiert. Die Funktional-Pragmatik fragt dagegen bei allen mündlichen und schriftlichen Äußerungen: „Welche mentalen Prozesse gingen einer Formulierung mental bei S/Au voraus?“ und „Was geschieht mental bei H/L?“ Bereits ältere Grundschulkinder können bezogen auf kleinste Handlungseinheiten beschreiben, dass „im Kopf“ etwas jeweils anderes passiert, wenn man Haus oder ich oder weil hört. Diese Wörter funktionieren unterschiedlich. Solche kleinsten sprachlichen Handlungseinheiten werden funktional-pragmatisch als Prozeduren bezeichnet. […]
Das Gesamtinventar dieser kleinsten Handlungseinheiten deckt sich mit dem der traditionellen Wortarten. Während in der traditionellen Grammatik die Elemente einer Sprache jedoch nach rein formalen Eigenschaften eingeteilt werden, sortiert man sie prozedural nach ihrer Funktion. Sprachliche Formen werden zu Verständigungszwecken (möglichst) funktional verwendet.
Handlungsformen sind „Sprechhandlungsverkettungen“ (Ehlich 1084), also Großformen des Handelns und gesellschaftlich vororganisiert (Hoffmann 2021, 28). Der Zweck von Text- und Diskursarten besteht darin, dass S/Au nicht jedesmal neu überlegen müssen, wie sie z. B. ein Kochrezept versprachlichen. Auch H/L erkennen, dass es sich um ein Kochrezept handelt und erwarten aufgrund ihres Weltwissens z. B. eine Zutatenliste. Handlungsformen entlasten S/Au also ebenso wie H/L, es ist aber nur sehr selten der Fall, dass feste Muster „abgespult“ werden können (wie etwa Ja, ich will im Handlungskontext Heiraten). Die Realisierung einer Handlungsform und die Wahl der konkreten sprachlichen Formen hängt immer vom Handlungskontext ab[.] […]
Wesentlich für die Entwicklung interaktionsbezogener Kontextsensitivität ist also, dass einzelne kommunikative Funktionen mit unterschiedlichen Formen realisiert werden können. Die Formenwahl sollte sich einerseits an der Handlungssituation und am Sprach- und Sachwissen von H/L orientieren, hängt aber selbstverständlich auch vom Formenrepertoire von S/Au ab.
Das Leitprinzip unseres handlungsbezogenen Ansatzes ist also der Formen-Funktionen-Zusammenhang, was keineswegs bedeutet, dass ausschließlich die Funktionen betrachtenswert sind. Vielmehr gehören Form und Funktion untrennbar zusammen und machen Grammatikunterricht erst richtig interessant. Dabei folgt die auserwählte Form immer der Funktion. Übergeordnetes Ziel dieser Art von Grammatikunterricht ist die Herausbildung von reflektierter Handlungskompetenz.
------------------------------------------------------------------------
Wenn Sie nun Lust bekommen haben, sich einmal intensiver mit diesem Ansatz eines nachhaltigeren Grammatikunterrichts auseinanderzusetzen, können Sie die „Handlungsbezogene Grammatikdidaktik“ hier bei uns bestellen.
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik