
Abkommensrechtliche Aufteilung der Einkünfte eines im internationalen Luftverkehr eingesetzten Piloten
Deutscher Pilot im internationalen Flugverkehr
Kläger ist ein in Deutschland ansässiger Pilot, der in den Streitjahren 2013 und 2014 bei einem Unternehmen mit Sitz der Geschäftsleitung in der Schweiz angestellt und sowohl im nationalen Flugverkehr in der Schweiz wie auch im internationalen Flugverkehr eingesetzt war. Vom Arbeitslohn behielt sein Arbeitgeber Quellensteuer ein. Der Kläger ist unbeschränkt steuerpflichtig und nach Art. 4 Abs. 2 Buchst. a DBA-Schweiz abkommensrechtlich in Deutschland ansässig. Streitig war nun die abkommensrechtliche Aufteilung seiner Einkünfte.
Wer hat das Besteuerungsrecht?
Das FG Berlin-Brandenburg entschied in erster Instanz, dass für die Frage, ob eine Arbeit in der Schweiz ausgeübt werde, bei einem internationalen Flug allein maßgeblich sei, ob dieser in der Schweiz beginne oder ende mit der Folge, dass keine Aufteilung auf Abschnitte in der Schweiz oder außerhalb der Schweiz vorzunehmen sei.
Der BFH sah dies im Revisionsverfahren anders. Zwar sei das FG zutreffend davon ausgegangen, dass das Besteuerungsrecht für die Einkünfte des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit Deutschland als Ansässigkeitsstaat und daneben der Schweiz als Tätigkeitsstaat bzw. Unternehmensstaat zustehe. Gleichwohl hat das FG zu Unrecht die Einkünfte überwiegend mit der Begründung von der Besteuerung ausgenommen, dass gemäß Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 Buchst. d DBA-Schweiz die Arbeit an Bord eines Luftfahrzeugs im internationalen Verkehr als in der Schweiz ausgeübt anzusehen sei, wenn der jeweilige Flug in der Schweiz beginne oder ende.
Freistellung der Einkünfte unter Progressionsvorbehalt nach Territorialitätsprinzip
Weder der Schweiz als Unternehmensstaat noch Deutschland als Ansässigkeitsstaat steht für Einkünfte des Klägers als angestellter Pilot bei der I AG jeweils das ausschließliche Besteuerungsrecht nach Art. 15 Abs. 1 bzw. 3 DBA-Schweiz zu mit der Folge, dass beide Staaten ein entsprechendes Besteuerungsrecht haben. Dies gilt hier sowohl für die Inlandsflüge als auch für solche im internationalen Verkehr.
Nach Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 Buchst. d DBA-Schweiz werden bei einer in Deutschland ansässigen Person die aus der Schweiz stammenden Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit i. S. d. Art. 15 DBA-Schweiz von der Bemessungsgrundlage der deutschen Einkommensteuer unter Progressionsvorbehalt ausgenommen, wenn sie nach den dem Art. 24 voranstehenden Artikeln des DBA-Schweiz in der Schweiz besteuert werden können und die nichtselbständige Arbeit in der Schweiz ausgeübt wird.
Liegen die Voraussetzungen für eine Freistellung nicht vor, wird nach Art. 24 Abs. 1 Nr. 2 DBA-Schweiz i. V. m. § 34c EStG die schweizerische Steuer auf den Teil der deutschen Einkommensteuer angerechnet, der auf diese Einkünfte entfällt.
Die Einkünfte des Klägers sind insoweit von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen, als die Tätigkeit territorial auf dem Boden oder im Luftraum über der Schweiz ausgeübt wird. Allein soweit der Kläger auf Schweizer Boden und im Schweizer Luftraum tätig ist, gilt seine Tätigkeit i. S. d. Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 Buchst. d DBA-Schweiz als „in der Schweiz ausgeübt“.
Ausgehend vom Territorialitätsprinzip ist die Arbeit an Bord eines Luftfahrzeugs im internationalen Verkehr i. S. d. Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 Buchst. d DBA-Schweiz – entgegen der Ansicht des FG – nicht bereits deshalb vollständig als „in der Schweiz ausgeübt“ anzusehen, weil der jeweilige Flug in der Schweiz beginnt und endet, was sich zudem auch nicht aus Art. 15 Abs. 2 DBA-Schweiz herleiten ließe.
Fundstelle: Urteil des BFH vom 24. Oktober 2024 – VI R 28/22, veröffentlicht am 13. Februar 2025
Bei uns bleiben Sie auf dem aktuellen Stand im Bereich Steuerrecht. |
| Abonnieren Sie doch gleich hier unseren kostenlosen Newsletter Steuern. |
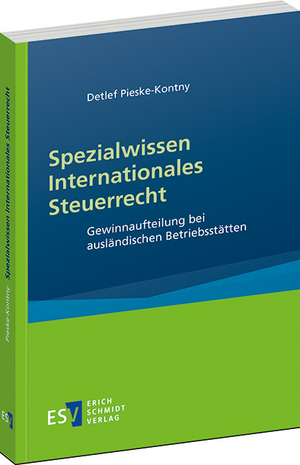 |
Spezialwissen Internationales Steuerrecht voraussichtlicher Erscheinungstermin: April 2025 von Dipl.-Kfm. Detlef Pieske-KontnyWie Gewinne zwischen Unternehmen und ihren ausländischen Betriebsstätten aufgeteilt werden, wird wesentlich durch den international anerkannten Fremdvergleichsgrundsatz bestimmt. Dabei gilt es nicht nur, ein Gleichgewicht zwischen Risiken der Steuervermeidung und der Vermeidung von Doppelbesteuerung zu finden. Auch muss etwa bedacht werden, dass z.B. einer ausländischen Betriebsstätte Gewinne zugerechnet werden könnten, obwohl insgesamt Verluste erwirtschaftet wurden.
Ein prägnanter Leitfaden, der Sie bei der Sachverhaltsaufklärung und der Einhaltung verkehrsüblicher Sorgfalt für optimale und rechtssichere Gestaltungslösungen unterstützt. |
(ESV/Da)
Programmbereich: Steuerrecht
