
„Analysekriterien für das Alltagsverständnis von Beleidigungen findet man nicht in einem Wörterbuch“
Annika Frank: Die Funktionale Pragmatik (FP) als sprachwissenschaftliche Theorie fundiert auf der Analyse sprachlichen Handelns in Alltag und Institutionen. Entsprechend bringt die FP es mit sich, dass man einen multiperspektivischen wie interdisziplinären Blick auf einen Analysegegenstand einnimmt bzw. einnehmen kann, bei mir also den des Beleidigungsalltags und der Beleidigungsprozessierung in juristischen Institutionen.
Hinzu kommt, dass insbesondere im Bereich der Äußerungsdelikte das Recht nicht ohne die Bezugnahme auf das alltagssprachliche Miteinander auskommt, also auf das schauen muss, was Menschen zueinander sagen, als beleidigend bewerten oder eben nicht. Das Gesetz kann nicht alle möglichen strafbaren Formen der Beleidigung listenhaft aufschreiben: Es bedarf einer Interpretation der Beleidigungshandlung in der jeweiligen Konstellation, in der sie realisiert ist.
Damit tut sich die Institution mitunter schwer, wie etwa am Fall von Renate Künast deutlich wurde: Die Politikerin wurde im Internet u. a. als „Drecks Fotze“, die „als Kind zu viel gef*** wurde“ bezeichnet. Erstinstanzlich verneinte ein Berliner Gericht hier die Beleidigung, was zu einer öffentlichen Debatte führte, weil viele Menschen dies doch sehr anders sahen – ein Urteil, das sie basierend auf ihrem Alltagsverständnis von Beleidigungen fällten. Im folgenden Revisionsverfahren sahen dies schlussendlich auch die Gerichte so, was den Einfluss der Gesellschaft und ihrem Äußerungsverständnis auf die Institution des Rechts belegt. Man sieht hier, dass es auch für den Alltag wenigstens einiger Analysekriterien bedarf. Man findet sie nicht in einem Wörterbuch.
Warum ist es so schwierig, eine Beleidigung als solche zu definieren?
Annika Frank: Eine Beleidigung ist nicht immer unbedingt an der sprachlichen Oberfläche erkennbar: Ich kann jemanden beispielsweise als „Arschloch“ bezeichnen und ihn damit freundschaftlich necken und gar nicht beleidigen, ich kann eine/n gute/n Kletterer/in als „Affen“ bezeichnen und ihm/ihr damit ein Kompliment machen, eine BIPoC (Black Indigenous Person of Color) mit derselben Bezeichnung massiv rassistisch beleidigen.
Man muss also immer die jeweilige Handlungskonstellation betrachten: Wer sagt was zu wem wo, wann und warum? Mithilfe des Handlungsmusters der Beleidigung, das ich erarbeitet habe, konnte ich Zwecke und Folgen herausarbeiten, wobei das Handlungsmuster etwa gegenüber sprechakttheoretisch fundierter Forschung, die z. B. „Regeln“ für erfolgreiche Beleidigungen aufstellt, flexibler ist und Sprecher, Hörer, deren Handlungen und Wissensprozessierungen einbezieht.
Inwiefern spielt die Diskursanalyse bei der Erschließung des Themenkomplexes ‚Beleidigung‘ eine Rolle?
Annika Frank: Die Diskursanalyse dient der Analyse sprachlichen Handelns in einer Gesellschaft: Sie ist fundiert auf echten Sprachdaten und bezieht in der Analyse nicht nur das Gesagte mit ein, sondern auch das Wissen der sprachlich Handelnden und wie dieses in der Handlungskonstellation wirkt. Anders als beispielsweise die Analyse der Beleidigung auf Basis literarischer Quellen habe ich für meine Arbeit Interviews geführt, in denen Menschen von tatsächlich erfahrenen und selbst begangenen Beleidigungen erzählt haben. Diese Alltagserzählungen, die eine typisch menschliche Form des Erfahrungs- und Erinnerungsaustausches sind, kommen dem Alltag des Beleidigens näher und sind weniger fiktional/literarisch aufgehübscht. Die Diskursanalyse ermöglichte es mir dann, in einem hermeneutischen Verfahren aus den alltäglichen Beleidigungserzählungen das sprachliche Handlungsmuster, das allen Beleidigungen als Tiefenstruktur unterliegt, herauszuarbeiten.
| Auszug aus: „Die Beleidigung. Diskurse um Ehre, Respekt und Integrität im Kontinuum zwischen Alltag und Recht“ | 14.12.2022 |
| Wer Worte wählt, die wehtun: Was eine Beleidigung ausmacht | |
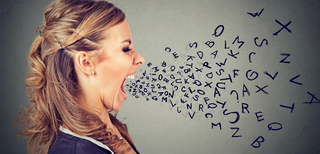 |
„Sie Idiot!“ – solche und ähnliche Ausrufe haben Sie bestimmt schon einmal mitbekommen, vielleicht sogar selbst formuliert. Beleidigungen wie diese prägen unseren Alltag mehr, als Sie eventuell vermuten. Doch was genau macht eine Beleidigung aus, wodurch wird sie charakterisiert und welche Konsequenzen kann sie mit sich bringen? mehr … |
Einige Beleidigungen werden als herabsetzender wahrgenommen als andere. Woran liegt das?
Annika Frank: In einer quantitativen Fragebogenstudie konnte ich herausfinden, dass solche Beleidigungen, die auf (vorgeblich) unveränderliche Merkmale des/der Beleidigten rekurrieren (z. B. das Geschlecht, die Ethnie, die Familie oder die Körperkonstitution), als tendenziell beleidigender empfunden werden als solche, die kulturspezifisch transformierte Charakteristika einbeziehen (z. B. bestimmte Tiernamen oder Skatologismen); kurz: „Fotze“ ist beleidigender als „Arschloch“.
Ein Grund dafür, dass erstere als beleidigender wahrgenommen werden, ist m. E., dass diese auf z. T. angeborene, vielfach unveränderliche Eigenschaften eines Adressaten verweisen und somit einen bedeutenden Teil des Selbstbilds und des persönlichsten, sozialen wie physischen Mikrokosmos ausmachen. Dadurch können sie direkt den persönlichsten Kern des Individuums treffen und in ihrem (potentiellen) Bezug auf wahre Sachverhalte unmöglich oder besonders schwer abzuwehren sein. Bei den Beleidigungen, die kulturspezifisch transformierte Charakteristika versprachlichen, gibt es hingegen häufig keine direkte Verbindung zum/zur Adressierten über einen wahren Sachverhaltskern, so dass sich die Beleidigungsfunktion vor allem im kulturell konventionalisierten Bruch eines sprachlichen Tabus entwickelt: Es ist eine negative Wertung ohne Wahrheitsanspruch und als Einzelmeinung des Beleidigenden dadurch leichter abstreitbar, wodurch sie auch als weniger beleidigend empfunden wird.
Gleichwohl generiert jede Beleidigung ihr Potential in der jeweiligen Handlungskonstellation, in der sie realisiert ist – es ist also etwas Individuelles, was immer auch mit der Biographie, der Position und den Erfahrungen des/der individuell Beleidigten verbunden ist. Eine Interviewteilnehmerin beispielsweise erzählt davon, dass sie ihren Chef als „Idioten“ bezeichnete; ein Beleidigungswort, das in meiner Fragebogenstudie einen eher niedrigen Beleidigungsgrad aufweist. Anhand der Reaktion des Chefs zeigt sich aber, dass er dies in der Situation wohl entschieden anders bewertete …
Sie schreiben u. a. von der „Kulturspezifik der Ehre“. Was verstehen Sie darunter und wo würden Sie Deutschland verorten?
Annika Frank: Forschungen zum Ehrverständnis haben belegen können, dass verschiedene Kulturen unterschiedliche Ehrverständnisse haben. In Deutschland ist die Ehre eher ein individuelles Gut einer einzelnen Person, also eng mit dem Selbstbild verknüpft, und nichts Kollektives, das sich auf eine Personengruppe bezieht. Auch im deutschen Recht spiegelt sich das individualistische Ehrverständnis wider, da mit den Beleidigungstatbeständen (14. Abschnitt StGB) die Ehre bzw. Würde des Einzelnen geschützt wird. Wenn mich also jemand beleidigt, ist damit nicht die Ehre meiner ganzen Familie angegriffen, sondern nur meine eigene. In anderen Kulturen kann das anders sein: Die Ehre einer Frau ist mitunter eng verknüpft mit der ihres Mannes, so dass eine Ehrverletzung des einen auch immer eine des anderen bedeutet.
Die jeweilige (Ehr-)Kultur hat dann natürlich auch einen Einfluss darauf, was überhaupt eine ehrverletzende Beleidigung sein kann. So sind z. B. auch sprachliche Höflichkeitssysteme unterschiedlich ausgeprägt – im Japanischen deutlich vielfältiger als im Deutschen, wo man v. a. zwischen Duzen und Siezen differenziert. Ein weiteres Beispiel: Es zeigt sich, dass wir im Deutschen eine Vielzahl skatologischer Beleidigungswörter haben, in anderen europäischen Ländern dafür mehr sexistische. Die Präferenz des Deutschen für das Skatologische wird u. a. damit erklärt, dass die Deutschen ein sehr ordentliches und reinliches Volk seien und entsprechend alles, was mit ‚Scheiße‘ zu tun hat, einen besonderen sprachlich-kulturellen Tabubruch darstellt.
Sie beleuchten zahlreiche Aspekte der ‚Beleidigung‘ – welche Bereiche könnte die Forschung zukünftig darüber hinaus fruchtbar machen?
Annika Frank: Zur Beleidigung ist sicherlich noch nicht alles gesagt. Insbesondere im Internet finden sich täglich neue Beleidigungsszenarien. Das soziale Miteinander im Netz erscheint derzeit noch nicht ausreichend reguliert und es stellt sich vielfach die Frage, was man wie regulieren kann, muss oder sollte. Der Gesetzgeber hat u. a. mit den Novellierungen des § 185 StGB im April 2021 einen ersten Ansatz geliefert (öffentliche Beleidigungen wie z. B. im Internet sind seitdem ein Qualifikationstatbestand, der zu härterer Bestrafung führen kann), wobei sich noch zeigen wird, ob dies in der Rechtspraxis einen Einfluss hat. Die pragmatische Linguistik ist hier sicherlich gefragt, den kommunikativen Rahmen im Digitalen anhand von Datenkorpora zu analysieren.
Weiterhin wäre eine konkret-interkulturelle Beleidigungsanalyse von großer Bedeutung. Das gilt auch für das Verständnis interkultureller Kommunikation, das in der globalen Gesellschaft immer wichtiger geworden ist. Eine scheinbar kleine Beleidigung kann eine unerwartet große Resonanz entfalten.
Vielen Dank für dieses sehr interessante Interview!
| Zur Autorin Annika Frank studierte Angewandte Sprachwissenschaften in Bachelor und Master an der TU Dortmund. Derzeit ist sie als Lehrende im Weiterbildungszertifikat „Deutsch als Zweitsprache“ an der TU Dortmund tätig. In ihrer Forschung befasst sie sich stets mit aktuellen, gesellschaftlichen Themen, zum Beispiel der Sprachverwendung im Fußball oder eben der Beleidigung, um so die Bedeutung linguistischer Forschung auch für Alltag/Gesellschaft aufzuzeigen bzw. ihre Ergebnisse nutzbar zu machen. Nebenberuflich war sie lange Zeit journalistisch tätig, sodass sie eine Affinität zu tagesaktuellen Themen beibehalten hat. |
 |
Die Beleidigung. Diskurse um Ehre, Respekt und Integrität im Kontinuum zwischen Alltag und Recht Von Annika Frank Beleidigungen gibt es in jeder Kultur, jedes Mitglied einer Gesellschaft hat schon einmal Erfahrungen mit Beleidigungen gemacht und erkennt sie, wenn sie auftreten. Nichtsdestotrotz ist es gar nicht so einfach, ‚die Beleidigung‘ in Form, Funktion und Wirkung genau zu definieren. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik
