
„Bausteine für eine gute Unterrichtsatmosphäre sind Offenheit, gegenseitiger Respekt und Vertrauen“
Lieber Thomas, warum ist ein kultursensibles Unterrichten wichtig?
Frank Thomas Grub: Zunächst einmal würde ich sagen, ist es grundsätzlich wichtig, sensibel zu unterrichten. Das ist meines Erachtens eine wichtige Voraussetzung für guten und erfolgreichen Unterricht überhaupt. Der kulturelle Aspekt kann in manchen Unterrichtssituationen eine Rolle spielen, beispielsweise wenn man als Lehrende/-r den Hintergrund der Lernenden kennen muss, der mitunter die Lehr-/Lernsituation beeinflusst. Und unterrichtet man aus der Perspektive der deutschsprachigen Länder im Ausland, gelten die dortigen Gesetze, Normen und Regeln; auch das hat mit Kultur zu tun.
Andererseits ist der Kulturbegriff problematisch, denn was ist eigentlich Kultur? Und laufen wir nicht Gefahr, manche Dinge allzu schnell als ‚kulturell bedingt‘ zu erklären – oft in einem (ab-)wertenden Sinne?
Ist die Rücksichtnahme auf kultursensible Themen eine neue Entwicklung, oder gibt es den Ansatz der Kultursensibilität schon länger?
Frank Thomas Grub: Ich würde Kultursensibilität nicht als Ansatz bezeichnen, denn das Wort „Ansatz“ suggeriert ja etwas mehr oder weniger Geschlossenes, und darum geht es eigentlich nicht. Das mag merkwürdig klingen, da das Heft ja „Kultursensibel unterrichten“ heißt. Aber besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang Offenheit – und damit auch das Offensein im Zuge der Unterrichtskommunikation: für das, was gesagt wird, aber auch für das, was nicht gesagt wird oder nonverbal zum Ausdruck gebracht wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass Unterricht stets auch ein Machtgeschehen bedeutet.
Eine neue Entwicklung ist das eigentlich nicht, aber es ist mehr als „Alter Wein in neuen Schläuchen“. Denn Begriffe wie ‚Kultursensibilität‘ können den Blick auf Herausforderungen im Unterricht lenken und somit zur Reflexion anregen.
Nun etwas detaillierter: Welche Rolle spielt das von Maurice Halbwachs geprägte und von Jan und Aleida Assmann weiterentwickelte Konzept des kollektiven Gedächtnisses in diesem Bereich des Lehrens und Lernens?
Frank Thomas Grub: Ich bin immer etwas hin- und hergerissen, wenn es um dieses Konzept im Zusammenhang mit dem Deutschen als Fremdsprache bzw. Deutschen als Zweitsprache geht. Denn eigentlich handelt es sich um eine grobe Vereinfachung der Überlegungen von Halbwachs bzw. der Assmanns, die sich ja auf andere Bereiche beziehen. Das kollektive bzw. das kulturelle Gedächtnis ist aber eine geeignete Denkfigur für das von einer Gemeinschaft geteilte Wissen, und dazu gehören zum Beispiel auch Geschichte und Traditionen. Es kann für den Unterricht und dessen Planung hilfreich sein, über dieses Wissen zu verfügen, wie zum Beispiel an Björn Karlssons Beitrag über die Malvinas/Falkland-Inseln deutlich wird: Karlsson zeigt, welche Herausforderungen historische Ereignisse für die Gegenwart mit sich bringen können – und auch, wie man diesen Herausforderungen im Unterricht begegnen kann. Um einer möglichen Kritik vorab zu begegnen, möchte ich betonen, dass man kein Historiker sein muss, um sensibel zu unterrichten.
| Auszug aus „Fremdsprache Deutsch Heft 71: Kultursensibel unterrichten“ | 24.10.2024 |
| Kultursensibel unterrichten – ein Idealzustand? | |
 |
Die Art, wie wir sprechen, und die Beispiele, die wir nutzen, um grammatische Phänomene zu erklären, spiegeln auch immer eigene Wertevorstellungen und gesellschaftliche Normen wider. Dabei ist es wichtig, sich die Pluralität der Lernenden und deren Erfahrungen bewusst zu machen, um möglichst unproblematisch mit sensiblen Themen umzugehen und den Unterrichtsraum zu einem safe space zu machen. mehr … |
Besonders im Umgang mit kontroversen Themen oder kultursensiblen Situationen ist es wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle am Unterricht Beteiligten wohlfühlen. Wie schafft man solch einen safe space?
Frank Thomas Grub: Das ist eine sehr gute Frage, auf die es aber keine allgemeingültige Antwort im Sinne eines „Patentrezepts“ geben kann. Uns Lehrenden kommt hier eine Schlüsselrolle zu. Bausteine für eine gute Unterrichtsatmosphäre sind Offenheit, gegenseitiger Respekt und Vertrauen, auch in die Fähigkeiten der Lernenden. Empathie ist ein wichtiger Faktor, eng damit verbunden die Fähigkeit und Bereitschaft zur Perspektivübernahme. Diese Faktoren lassen sich schulen. Wie das konkret aussehen kann, zeigt zum Beispiel Thomas Polland in seinem Beitrag: Er stellt eine Unterrichtssequenz vor, in der es um „Kompetenzschulung an den Grenzen von Reden und Schweigen“ geht.
Sich wohlfühlen bedeutet übrigens nicht, dass alles „Friede, Freude, Eierkuchen“ ist oder sein soll – kontroverse Themen bieten vielmehr Chancen zum Dialog und zum Entwickeln von Kompetenzen wie der Fähigkeit zum ‚kritischen Denken‘, das vielerorts fester Bestandteil der Curricula ist.
Inwiefern bietet es sich innerhalb dieses Ansatzes an, Medien wie Filme, Romane oder Hörspiele zu nutzen? Welche Gefahren und Möglichkeiten bergen fiktionale Darstellungen von bspw. Fluchterfahrungen oder Queerness?
Frank Thomas Grub: Beim Einsatz von Medien wie Literatur, Filmen und Hörspielen sehe ich vor allem Möglichkeiten, erst recht, wenn es sich um authentische Materialien handelt. Oft sind diese Medien multiperspektivisch angelegt, so dass buchstäblich mehrere Stimmen zu Wort kommen, mehrere Positionen erscheinen. Je nachdem, mit welchen Figuren man sich identifiziert, kann man für sich selbst durchspielen, wie eine Situation sich anfühlt, wie man selbst anstelle der Figuren (re-)agieren würde; man kann das auch als „Probehandeln“ bezeichnen. Konkrete Beispiele bieten Dieter Jaeschkes Beitrag über den queeren Spielfilm „Die Mitte der Welt“ und Iris Wolfs Beitrag über „Das Schicksal der Sterne“, in dem es um Flucht- und Migrationserfahrungen geht.
Gefahren liegen vermutlich nicht in der Fiktionalität an sich, sondern, im Hinblick auf zum Beispiel Fluchterfahrungen, vor allem in einer potentiellen Re-Traumatisierung der betroffenen Lernenden. Apropos „safe space“ bzw. „safe spaces“: Sollte dies trotz aller Umsicht geschehen, sind Lehrende, die die eben genannten Eigenschaften mitbringen, sicher besser in der Lage, die betroffenen Lernenden aufzufangen. Hier gibt es sicher keine goldene Regel; wir sollten jedenfalls die Lernenden und deren Potential nicht unterschätzen.
Die genannten Medien sollten zudem nicht auf ihre inhaltliche Dimension reduziert werden – Sprache und Ästhetik sind hier ebenso wichtig und können im Unterricht thematisiert werden.
Welchen Tipp hast du für Lehrkräfte, die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben?
Frank Thomas Grub: Tipps sind eigentlich schon in den Antworten auf die bisherigen Fragen angeklungen, und ich bin sicher, dass viele Kolleginnen und Kollegen diese Aspekte in ihrem Unterricht berücksichtigen. Ich denke, dass schon sehr viel erreicht werden kann, wenn man offen ist für die Lernenden, wenn man Interesse für deren Lebensgeschichte(n) zeigt und ihnen – soweit dies die Rahmenbedingungen erlauben – auf Augenhöhe begegnet.
Ein weiterer Tipp ist, Lehr-/Lernprozesse gemeinsam mit den Lernenden zu besprechen und die Lernenden aktiv in die Unterrichtsplanung mit einzubeziehen; das gilt nicht nur für fortgeschrittene Lernende und kann zum Beispiel die Themenwahl betreffen. Ein Schlüsselbegriff ist hier das vielleicht ein wenig altmodisch klingende Wort der ‚Teilhabe‘.
Die formulierten Ideale sind anspruchsvoll und vermutlich nicht immer zu erreichen, mancherorts möglicherweise auch gar nicht erwünscht. Darüber würde ich mir übrigens eine breitere Diskussion wünschen, zumal Idealismus nicht zwangsläufig zu besserem Unterricht führt. Zugleich sind wir als Lehrende wichtige Bezugspersonen für die Lernenden, und mit Bewusstsein für unsere Gegenüber und deren Situation ist schon viel gewonnen.
Wir danken dir sehr für das Interview!
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Hier können Sie die Ausgabe bestellen.
| Der Herausgeber |
| Frank Thomas Grub ist professor i tyska an der Universität Uppsala, Schweden. Nach dem Ersten Staatsexamen in den Fächern Deutsch und Französisch für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen sowie einem Aufbaustudium des Deutschen als Fremdsprache wurde er 2003 mit einer Arbeit über ‚Wende‘ und ‚Einheit‘ im Spiegel der deutschsprachigen Literatur an der Universität des Saarlandes zum Dr. phil. promoviert. Von 2005–2010 war er DAADLektor an der Universität Göteborg, danach universitetslektor an den Universitäten Göteborg und Uppsala. Zu seinen Arbeitsgebieten zählen neben der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart die Didaktik von Literatur und Landeskunde in Unterricht und Lehre des Deutschen als Fremdsprache. |
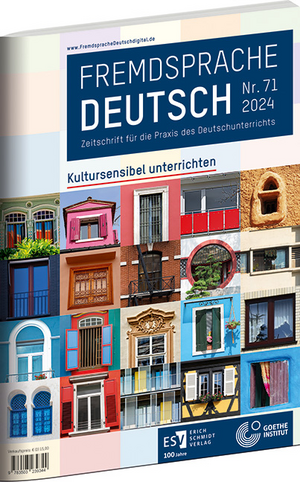 |
Fremdsprache Deutsch Heft 71 (2024): Kultursensibel unterrichten Themenheftherausgeber: Frank Thomas Grub Ob in der Schule, an der Universität oder im Rahmen von Sprachkursen – alle, die wir Deutsch als Fremd- bzw. Deutsch als Zweitsprache unterrichten, kennen Unterrichtssituationen, die mit den Begriffen sensibel bzw. kultursensibel beschrieben werden können. Häufig hängen diese Situationen mit den gewählten Themen zusammen, die – je nachdem, an welchem Standort wir uns befinden – explizit auf dem Lehrplan bzw. im Curriculum stehen, tabubehaftet sein können oder gar verboten sind. |
Programmbereich: Deutsch als Fremdsprache
