
Kultursensibel unterrichten – ein Idealzustand?
-----------------------------------------------------------
Vorüberlegungen
Kultursensibel unterrichten lässt sich als Formulierung eines Idealzustands verstehen. Dieser Wortwahl liegt zugleich die Annahme zugrunde, dass es Unterrichtssituationen gibt, die mit den Begriffen sensibel bzw. kultursensibel beschrieben werden können. […]
Auch wenn dies naheliegen mag: Kultursensibles Unterrichten ist keineswegs auf den Bereich der Landeskunde bzw. des kulturellen, kulturbezogenen oder auch kulturreflexiven Lernens – um nur einige der konkurrierenden Begriffe zu nennen – oder die Auseinandersetzung mit literarischen Texten (vgl. dazu z. B. Grub 2020) oder Filmen beschränkt, sondern kann ebenso relevant werden im Zusammenhang mit der Vermittlung beispielsweise von Grammatik: Welche grammatischen Herausforderungen bringt beispielsweise der Anspruch einer diskriminierungsfreien Sprache mit sich? Aspekte wie dieser sind keineswegs auf Standorte beschränkt, an denen die Politik restriktive Vorgaben macht.
Diese einleitend formulierten Überlegungen zeigen bereits, dass es um konstruktive Auseinandersetzungen mit sensiblen Themen gehen soll und keineswegs darum, potenziell sensible Themen präventiv auszuschließen. Die Thematik wird im Kontext der Möglichkeiten dynamischer, also flexibler, Lehr-/Lernbedingungen gesehen, in deren Rahmen ein sicheres Umfeld bzw. sichere Raume (safe bzw. brave spaces) eingerichtet, aufgebaut und gestaltet werden können.
Kultursensible Themen?
Lehrmaterialien und kultursensible Themen
Ob man mit Lehrwerken arbeitet oder mit frei gewählten Materialien: Eine wichtige Voraussetzung für ein gelungenes Unterrichtsgespräch besteht darin, mögliche Assoziationen der Lernenden zu kennen und etwaige Reaktionen abschätzen zu können: Wird in den Lehrwerken Gewalt erwähnt und ggf. auch dargestellt? Was können die Konsequenzen sein, wenn die Lernenden mit diesen Quellen konfrontiert werden? Sind in der Gruppe Geflüchtete, die – beispielsweise aufgrund von Traumatisierungen – Schwierigkeiten mit dem Dargestellten haben könnten? Diese Fragen thematisiert im vorliegenden Heft zum Beispiel auch Iris Wolf (S. 46–53).
In vielen Lehrwerken werden traditionelle Kernfamilien dargestellt: Vater, Mutter, zwei Kinder: ein Sohn, eine Tochter. Welches Bild von Deutschland bzw. der deutschsprachigen Länder wird dadurch vermittelt? Was bedeutet es für die Lernenden, wenn verschiedene Konzepte von Familie thematisiert werden und diese ggf. mit vorhandenen Vorstellungen kollidieren? Was geht in Schülerinnen und Schülern vor, die sich nicht mit der heterosexuellen Kernfamilie identifizieren können oder wollen? In Lehrwerken werden Normen bzw. ›Normalität‹ schließlich nicht nur gespiegelt, sondern auch verfestigt bzw. konstruiert. […]
Welche Assoziationen wecken Beispielsätze wie ≫Die Soldaten marschierten zu dritt in einer Reihe≪ (Helbig/Buscha 2005, 388) oder ≫Der Soldat starb, indem er von den Kugeln der Feinde getroffen wurde≪ (ebd., 586; Hervorhebung im Original)? Welche Vorstellung von Erziehung weckt folgender Satz: ≫Das Kind wird bestraft, damit es aus seinen Fehlern lernt≪ (ebd., 612)? Welche Geschlechterrollen vermitteln die folgenden Beispielsätze: ≫Die Mutter backt (der Tochter) den Kuchen≪ (ebd., 149) oder ≫Der Vater unterstützt den Sohn≪ (ebd., 151)? […]
Das könnte Sie auch interessieren:
| Auszug aus „Kulturstudien im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“ | 22.10.2024 |
| Interdisziplinäre Kulturstudien statt traditioneller Landeskunde | |
 |
Grammatik und Vokabeln stimmen – und trotzdem kommt es in Unterhaltungen in Fremdsprachen häufig zu Missverständnissen. Die Relevanz kulturellen Wissens in der Kommunikation ist nicht zu vernachlässigen – Sprachmuster und Routinen, aber auch intertextuelles Wissen sind wichtig, damit unsere Worte Bedeutung erhalten. Die traditionelle Landeskunde, die sowohl Lernende als auch „den deutschsprachigen Raum“ als homogenes Ganzes ansieht, wird nun abgelöst durch neuere Ansätze der Kulturstudien, die diesen Bereich interdisziplinärer begreifen. mehr … |
Bewusstsein schaffen
Kann man sich überhaupt auf kultursensible Situationen vorbereiten? Man kann – vermutlich jedoch nicht spontan und kurzfristig, sondern vor allem über das Schaffen einer entsprechenden Lehr-/Lernatmosphäre, wie auch Thomas Polland in seinem Beitrag anhand konkreter Übungen zeigt (S. 38–45). Dabei ist es zunächst einmal wichtig, dass man die Lerngruppe kennt. Das bedeutet unter anderem, dass man als Lehrperson zumindest teilweise mit den persönlichen Erfahrungen, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen, vertraut ist – oder zumindest ein Gespür dafür besitzt.
Der Unterrichtsraum sollte im Idealfall ein geschützter Raum (safe space) sein, in dem die Lernenden sich sicher fühlen, eigene Sichtweisen einbringen können und ganz einfach auch Fehler machen dürfen. Fehler machen zu dürfen – und somit aus diesen Fehlern lernen zu können – ist meines Erachtens eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der Lernenden. […]
Offenheit – ggf. in Verbindung mit dem Markieren von Grenzen – ist demnach die Basis für den Umgang mit kultursensiblen Situationen. Dabei ist nicht zu vergessen, dass Unterricht stets auch ein Machtgeschehen ist. Dies gilt selbstverständlich nicht nur für den schulischen Raum, sondern für jeglichen Sprachvermittlungskontext. Schweigen seitens der Schülerinnen und Schüler muss keineswegs eine Bestätigung der Sicht der Lehrenden bedeuten. Und Äußerungen können auch nonverbal erfolgen, so dass hier besondere Wachsamkeit geboten ist. Mit anderen Worten: Was nicht gesagt wird, kann wichtiger sein als das, was gesagt wird – erst recht vor dem Hintergrund begrenzter sprachlicher Mittel.
--------------------------------------------------------
Wenn Ihr Interesse geweckt ist und Sie erfahren wollen, welche praktischen Ansätze es für kultursensibles Unterrichten gibt, können Sie hier die neue Ausgabe der Zeitschrift „Fremdsprache Deutsch“ bestellen. Alle Hefte der Zeitschrift finden Sie auch online.
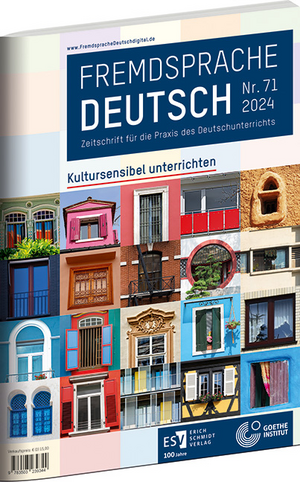 |
Fremdsprache Deutsch Heft 71 (2024): Kultursensibel unterrichten Herausgegeben vom Vorstand des Goethe-Instituts und Andrea Ender, Christian Fandrych, Petra Klimaszyk, Imke Mohr, Ingo Thonhauser und Wassilios Klein Ob in der Schule, an der Universität oder im Rahmen von Sprachkursen – alle, die wir Deutsch als Fremd- bzw. Deutsch als Zweitsprache unterrichten, kennen Unterrichtssituationen, die mit den Begriffen sensibel bzw. kultursensibel beschrieben werden können. Häufig hängen diese Situationen mit den gewählten Themen zusammen, die – je nachdem, an welchem Standort wir uns befinden – explizit auf dem Lehrplan bzw. im Curriculum stehen, tabubehaftet sein können oder gar verboten sind. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik
