
Chunks: Schlüssel zur Wissenschaftssprache
Die Verteilung von Chunks auf die morphosyntaktischen Kategorien
Im Lernerkorpus wurden insgesamt 1.331 verschiedene Chunks (Types) identifiziert, deren Häufigkeiten variieren. Die Mehrheit dieser Chunks (1.093 Types, 82 %) tritt nur einmal auf, während sich 238 Chunks mindestens zweimal wiederholen (siehe Abb. 19). […] Die untersuchten Lernenden verfügen über individuelle Repertoires an Chunks, deren Überschneidungen eher gering sind (siehe Abb. 20). Von den erfassten Chunks werden 90 % (1.200 Types) jeweils nur von einem/einer einzelnen Lernenden verwendet, dagegen gerade 10 % (131 Types) von mehreren Lernenden. […]
Chunks lassen sich morphosyntaktisch in zehn Kategorien unterteilen (siehe Kap. 2.3.2.1). Da Chunks verschiedener Kategorien auf unterschiedliche Weise verwendet werden können, erfolgt eine Darstellung der Verteilung von Chunks bei Lernenden auf morphosyntaktische Kategorien, wobei die Chunks bei Muttersprachler/-innen als Kontrolldaten dienen. In diesem Kapitel soll überprüft werden:
- Wie verwenden Lernende Chunks?
- Welche Merkmale weisen ihre Chunks auf?
- Inwieweit unterscheidet sich ihr Chunk-Gebrauch von dem der Muttersprachler/-innen?
Verbale Wortgruppe
[…]
Einige verbale Wortgruppen weisen eine hohe Häufigkeit auf, obwohl diese Kategorie im Allgemeinen einen niedrigen Wiederholungsgrad zeigt. Bei Lernenden werden acht verbale Wortgruppen besonders häufig verwendet, also als „Teddybär-Chunks“, nämlich (eine) Rolle spielen (7-mal), mit etwas zu tun haben (6-mal), Frage stellen (6-mal), Sinn machen (5-mal), vor Augen haben (4-mal), Frage verstehen (4-mal), in der Lage sein (4-mal), und Beispiel geben (4-mal). Diese gehören ebenfalls zu den Chunks im engeren Sinne.
Lernende zeigen ihre starke Individualität in der Verwendung verbaler Wortgruppen. Die Mehrzahl verbaler Wortgruppen (483 Types, 96,6 %) wird jeweils von einem/einer einzelnen Lernenden verwendet, während nur 17 verbale Wortgruppen in den Texten verschiedener Lernender auftreten (siehe Abb. 24). Von diesen 17 werden zwei, also mit etwas zu tun haben und (eine) Rolle spielen, von vier Lernenden gemeinsam verwendet. Drei, nämlich Frage verstehen, Frage stellen und in der Lage sein, kommen in den Texten von je drei Lernenden vor. Diese fünf gehören auch zu den acht am häufigsten verwendeten verbalen Wortgruppen im letzten Abschnitt. […]
Verbale Wortgruppen bei Lernenden weisen einen niedrigen Wiederholungsgrad auf. Allerdings zeigen die Verben, die in verbalen Wortgruppen als Kopf fungieren, einen hohen Wiederholungsgrad. In den 577 verbalen Wortgruppen werden 241 Verben (Types) verwendet, was einem TTR-Wert von 0,4160 entspricht. Der hohe Wiederholungsgrad ist der häufigen Verwendung einer kleinen Anzahl von Verben geschuldet. Während 141 Verben (58,51 %) nur einmal auftreten, zeigen vier Verben eine besonders häufige Verwendung: haben (69-mal), machen (21-mal), geben (16-mal) und verstehen (15-mal). Mit 121 Belegen machen diese Verben 20,97 % aller erfassten Verben (Tokens) aus. In diesem Zusammenhang ist anzunehmen, dass sie von Lernenden oft als „lexical teddy bear“ verwendet werden.
Um die häufige Verwendung dieser vier Verben zu begründen und zu interpretieren, wurden verschiedene Ressourcen konsultiert: A Frequency Dictionary of German (Tschirner/Möhring 2020), das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) (https://www.dwds.de) und die Wortliste nach Sprachniveau des Goethe-Instituts. Grundsätzlich lässt sich ihre häufige Verwendung anhand dreier Aspekte erklären:
-
Hohe Häufigkeit: Diese vier Verben – haben (Platz 2), machen (Platz 21), geben (Platz 7) und verstehen (Platz 44) – befinden sich in der oberen Hälfte der Liste der 100 häufigsten Verben (vgl. Tschirner/Möhring 2020: 299). Im DWDS erreichen sie ebenfalls hohe Platzierungen in der Häufigkeitsskala, nämlich haben (7), machen (6), geben (6) und verstehen (5). Die hohe Häufigkeit gewährleistet die Zugänglichkeit: Lernende stoßen regelmäßig auf sie und können sie deshalb gut im Gedächtnis behalten. Dies wurde in früheren Studien bestätigt: Die Frequenz ihrer Bestandteile kann die Verwendung von Wortverbindungen positiv beeinflussen (vgl. Nguyen/Webb 2017; Wolter/Yamashita 2018).
- Fossilisierung: Gemäß dem DWDS gehören diese vier Verben zum Wortschatz des Goethe-Zertifikats A1. Dies weist darauf hin, dass sie eine niedrige Lernschwierigkeit aufweisen und bereits in frühen Lernphasen vermittelt, erlernt und verwendet werden. Aufgrund ihrer begrenzten Sprachkenntnisse müssen Lernende in frühen Lernphasen auf einfache Wörter oder Wortverbindungen zurückgreifen, die sie erlernt haben. Sie sind mit diesen Ausdrücken vertraut und können sie leicht aus dem Gedächtnis abrufen. Obwohl sie später komplexe und „idiomatische“ Ausdrücke beherrschen und sich auf einem höheren Sprachniveau befinden, greifen sie aufgrund von Fossilisierung im L2-Erwerb weiterhin oft auf diese Ausdrücke zurück.
- Breite Anwendbarkeit:Ihre breite Anwendbarkeit lässt sich an der Anzahl ihrer Einträge erkennen. Haben, machen, geben und verstehen verzeichnen im DWDS je 10, 18, 14 und 8 Einträge. Je mehr Einträge ein Wort hat, desto vager und allgemeiner ist seine Bedeutung. Diese Verben können verschiedene Wörter verknüpfen und in verschiedenen Kontexten Anwendung finden, wobei ihre Verwendung wenigen Einschränkungen unterliegt, sowohl auf syntaktischer als auch auf semantischer Ebene. Außerdem machen sich Lernende bei der Verwendung dieser Verben selten Gedanken darüber, ob sie Fehler machen. Dadurch können sie ein Gefühl der Sicherheit erlangen.
| Nachgefragt bei Dr. Zhoufeng Wang | 19.03.2025 |
| „Chunks sollten Lernenden gezielt und systematisch vermittelt werden“ | |
 |
Das Erlernen einer neuen Sprache ist nicht leicht, insbesondere im akademischen Kontext haben Lernende oft Schwierigkeiten. Feste Wortverbindungen – sogenannte „Chunks“ – können Sprachverständnis und Sprachproduktion der deutschen Wissenschaftssprache jedoch entscheidend verbessern. Richtig angewandt können diese Mehrworteinheiten gerade in Prüfungssituationen eine Schlüsselrolle spielen und den Spracherwerb erleichtern. mehr … |
Bei der Verbauswahl zeigen Lernende und Muttersprachler/-innen sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede. Verben, die von Lernenden häufig genutzt werden, treten bei Muttersprachler/-innen ebenfalls häufig auf, nämlich haben (66-mal), machen (23-mal) und geben (9-mal). Diese drei Verben finden sich in 98 von 518 verbalen Wortgruppen der Muttersprachler/-innen (18,92 %). In dieser Hinsicht ähneln sich beide Gruppen in ihrer Verbpräferenz. Allerdings gibt es Verben, die von Muttersprachler/-innen häufig verwendet werden, jedoch von Lernenden selten genutzt werden, zum Beispiel bestimmen (11 vs. 1), darstellen (10 vs. 2), bekommen (6 vs. 1), und vermitteln (6 vs. 1). Diese Diskrepanz könnte durch folgende Punkte erklärt werden:
- Leicht niedrigere Häufigkeit: Mit Ausnahme von vermitteln befinden sich die übrigen Verben zwar in der Liste der 100 häufigsten Verben, jedoch weiter unten, nämlich bekommen (Platz 43), darstellen (Platz 93) und bestimmen (Platz 100). Im DWDS werden diesen zwar hohe Häufigkeitsstufen zugeordnet, aber ihre Stufen sind insgesamt niedriger, nämlich bekommen (6), bestimmen (5), darstellen (5) und vermitteln (5).
- Höhere Lernschwierigkeit: Mit Ausnahme von bekommen gehören die übrigen drei Verben zum Wortschatz des Goethe-Zertifikats B1, d. h., sie besitzen einen höheren Schwierigkeitsgrad und werden erst in späteren Lernphasen vermittelt und erlernt.
- Spezifische Bedeutung und begrenzte Kombinationsmöglichkeiten: Diese Verben haben im DWDS weniger Einträge: bekommen (3), bestimmen (6), darstellen (7) und vermitteln (3). Ihre Bedeutungen sind konkreter und spezifischer, wodurch ihre Kombinationsmöglichkeiten begrenzt sind. Sie werden in bestimmten Kontexten verwendet, ihre Verwendung unterliegt daher mehr Beschränkungen.
Zufälligerweise wurden in beiden Korpora jeweils 39 verbale Wortgruppen mit diesen Abstrakta (Types) gefunden (siehe Abb. 25). Allerdings zeigen sich signifikante Unterschiede in ihrer Verteilung: Lernende verwenden deutlich mehr Kollokationen (Types: 22 vs. 11), insbesondere starke Kollokationen (Types: 14 vs. 6), aber signifikant weniger freie Wortverbindungen (Types: 13 vs. 23). Dies bestätigt erneut, dass Lernende eine häufigere Verwendung von (starken) Kollokationen zeigen. […]
Kollokationen, insbesondere starke, lassen sich nicht willkürlich bilden, da die Kombination ihrer Bestandteile konventionalisiert ist (siehe Kap. 2.1). Die häufige Verwendung von Kollokationen durch Lernende zeigt, dass Lernende ein ausgeprägtes Kollokationsbewusstsein haben: Sie erkennen deren Relevanz. Daher lernen sie Kollokationen bewusst und setzen sie gezielt ein, um ihre Sprache sowohl wissenschaftlich als auch idiomatisch zu gestalten.
Sie sind neugierig, wie es um die anderen morphosyntaktischen Kategorien bestellt ist? Lesen Sie weiter: Der Titel kann hier bestellt werden.
| Zur Autorin |
| Dr. Zhoufeng Wang schloss ihr Germanistikstudium an der Universität Tongji mit einem Master ab. Als Stipendiatin der chinesischen Regierung wechselte sie an die Universität Erlangen-Nürnberg, wo sie unter Betreuung von Prof. Dr. Eva Breindl promovierte. Seitdem arbeitet sie als Assistenzprofessorin für Germanistik an der Universität Xiamen. |
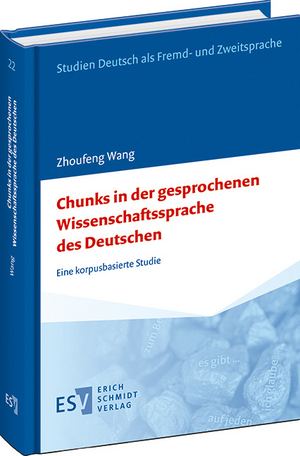 |
Chunks in der gesprochenen Wissenschaftssprache des Deutschen. Eine korpusbasierte Studie Von Zhoufeng Wang Deutsche Hochschulen genießen weltweit hohes Ansehen und ziehen viele internationale Studierende an. Deren Studienerfolge bleiben allerdings häufig hinter denen deutscher Studierender zurück. Die Gründe hierfür sind vielfältig – ein wichtiger Faktor ist zweifellos die eingeschränkte Sprachkompetenz, insbesondere der schwierige Umgang mit der deutschen Wissenschaftssprache. Deren Beherrschung ist jedoch eine notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewältigung des akademischen Alltags. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik
