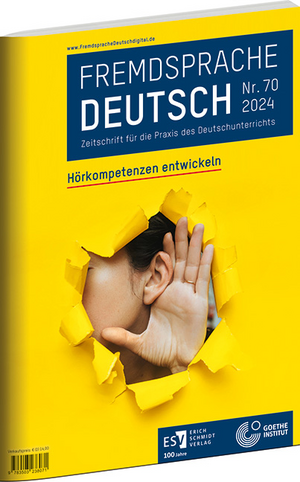„Das Auge hört mit“
Der folgende Auszug soll einen Einstieg in diese Thematik geben. Herausgeber Gunther Dietz gibt mit seinem Beitrag „Mit fremden Ohren. Überlegungen zur Didaktik des fremdsprachlichen Hörverstehens“ einen Vorgeschmack auf alle kommenden Inhalte dieser Ausgabe. Viel Spaß beim Lesen.
-------------------------------------------------------------------------------
Mit fremden Ohren. Überlegungen zur Didaktik des fremdsprachlichen Hörverstehens
(Gunther Dietz)
Einstieg: Hören als sperrige Fähigkeit
Aus der Perspektive der Lehrenden stellt sich Hören weitgehend als unsichtbare, wenig greifbare Fertigkeit dar: Weder die im Kopf ihrer Lernenden ablaufenden Prozesse noch das Hörverständnis als Resultat können unmittelbar beobachtet werden. Lesende können sich auf einen stabilen Input in Form eines schriftlich vorliegenden Textes stützen. Hier sind Wort- und Satzgrenzen durch Leer- und Interpunktionszeichen optisch klar markiert. Als Lesende können sie den Lesefluss jederzeit unterbrechen, sich im Text vor- oder zurückbewegen. Lesende haben also eine weitaus stärkere Kontrolle über die Gestaltung des Verstehensprozesses.
Hörende sind dagegen weitgehend der Flüchtigkeit des gesprochenen und äußerst variablen auditiven Inputs (vgl. Grotjahn 2005, 123) ausgesetzt, ja bisweilen ausgeliefert: Sie müssen in Echtzeit im Lautstrom einzelne Sequenzen als Wörter identifizieren. Erschwerend ist dabei, dass Wortgrenzen nicht systematisch markiert sind und die konkrete Aussprache einzelner Laute, Silben und Wörter sehr variabel ist. [...]
Hören in der Erstsprache, Hören in der Fremdsprache
In beiden Fällen finden dieselben Prozesse im Kopf statt. Allerdings zeigt sich, dass fremdsprachliches Hören im Vergleich zum erstsprachlichen Hören in vielen Fällen weniger routiniert und kommunikativ gesehen oft weniger erfolgreich verläuft.
Fremdsprachliche Hörende sind mit zahlreichen Hindernissen konfrontiert, die ein gelingendes Hören oft erschweren.
Für die fremdsprachliche Hörverstehensdidaktik kann somit der Schluss gezogen werden, dass den datengeleiteten Prozessen (Lautwahrnehmung, Worterkennung u. a.) eine wichtigere Rolle als bislang zukommen sollte und demzufolge verstärkt auch Trainingsformate zum Einsatz kommen sollten, die die Lernenden beim Dekodieren des auditiven fremdsprachlichen Inputs unterstützen.
| Nachgefragt bei Dr. Gunther Dietz | 30.04.2024 |
| „Hörverstehen und Hör-Seh-Verstehen sind immens wichtige Fertigkeiten für das Lernen einer Fremdsprache“ | |
 |
Anlässlich der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch zum Thema Hörkompetenzen entwickeln haben wir ein Interview mit dem Herausgeber geführt. Gunther Dietz befasst sich mit der Rolle des Hörens beim Erwerb einer Fremdsprache und erzählt, was diese neue Ausgabe so interessant macht. mehr … |
Zur Methodik und Didaktik des fremdsprachlichen Hörverstehens
Das seit Jahrzehnten praktizierte methodische Vorgehen in der Hörverstehensvermittlung untergliedert die Arbeit an einem Hörtext bekanntlich in drei Phasen: vor, während und nach dem Hören (Honnef-Becker / Kühn 2019, 178–188).
Die Fähigkeit zu dekodieren wird bei den Hörenden augenscheinlich vorausgesetzt, jedenfalls in der Regel nicht zum Gegenstand didaktischer Bemühungen gemacht. Das heißt, es findet meist kein Training von Bottom-up-Prozessen statt – wie Übungen zur Lautwahrnehmung, Worterkennung, Erkennung von Wortgrenzsignalen, syntaktische Analyse. […]
Jenseits von „Fragen zum Text“. Mikro-Hören als Arbeit an der lautlichen Substanz
Mikro-Hörübungen skizziert, die verschiedene Teilprozesse des Dekodierens fokussieren – von der Laut- und Silbenwahrnehmung über die Wort- und Äußerungsebene hin zur Ebene der Intonation und der Gewöhnung an Sprechervariation (Field 2008a, 163–208).
Das Merkmal ‚Mikro‘ bezieht sich auf eine kleinschrittige Vorgehensweise, bei der zum Teil sehr kurze Passagen von oft nur wenigen Sekunden des Hörmaterials mehrfach auditiv präsentiert und möglichst unmittelbar in der Unterrichtssituation reflektiert werden. Ausschlaggebend ist dabei, dass das zu übende Phänomen wiederholt im Hörmaterial vorkommt und so der Aufmerksamkeitsfokus auf eine bestimmte Komponente des Hörprozesses (z. B. Worterkennung) bzw. ein auditiv relevantes Phänomen gelegt wird.
In diesem Heft wird in den Beiträgen von Anika Meyer sowie Julia Festman, Sabrina Gerth, Christine Reiter und von Gunther Dietz exemplarisch aufgezeigt, wie Mikro-Hörübungen gestaltet und im Unterricht genutzt werden können. […]
| FD 70: Hörkompetenzen entwickeln | 24.04.2024 |
| Kostenfreie Webinare: Hörkompetenzen entwickeln im Fach DaF/DaZ | |
 |
Zwei kostenfreie Webinare im Mai geben Ihnen einen Eindruck der neuen Ausgabe von Fremdsprache Deutsch! Passend zur aktuellen Ausgabe 70 Hörkompetenzen entwickeln bietet das Goethe-Institut zwei Webinare am 02.05. und 30.05. an. mehr … |
Plädoyer für authentische Hör-Seh-Materialien
Als authentisch werden dabei in der Regel Texte bezeichnet, die nicht eigens für didaktische Zwecke produziert wurden, sondern Ausschnitte aus der kommunikativen Lebenswelt einer Sprachgemeinschaft repräsentieren (Dietz 2022, 21).
In diesem Heft finden sich Didaktisierungen zu authentischen Hörmaterialien der gesprochenen Alltagssprache (Susanne Horstmann, Anika Meyer und Gunther Dietz), aber auch der Wissenschaftssprache (Martin Wichmann / Juliane Michelini) sowie zu Radionachrichten (Dóra Pantó-Naszályi) und Popsongs (Christiane Bolte-Costabiei / Anja Schümann).
„Das Auge hört mit“: Chancen des Hör-Seh-Verstehens
Für den Einsatz audiovisueller Materialien in der DaF- und DaZ-Unterrichtspraxis spricht, dass Hör-Seh-Verstehen im Allgemeinen natürlicher ist als das reine Hörverstehen. Mimik, Gestik, Körperhaltung der Sprechenden, Lippenbewegungen, aber auch die bildhafte Präsentation der Kommunikationssituation und der in ihr stattfindenden kommunikativen Handlungen – all diese visuellen Informationen können die auditiven Verstehensprozesse unterstützen. Allerdings hat die Forschung auch gezeigt, dass visueller Input das Verstehen nur dann erleichtert, wenn er den auditiven Input „in sinnvoller Weise ergänzt“ (Porsch et al. 2010, 181).
Die vorliegenden Untersuchungen zum Hör-Seh-Verstehen legen nahe, dass es sich beim fremdsprachlichen Hör-Seh-Verstehen nicht nur um ein visuell angereichertes Hörverstehen handelt, sondern um eine eigenständige Verstehens-Kompetenz. […]
Didaktische Vorschläge zum Hör-Seh-Verstehen finden sich in diesem Themenheft im Beitrag von Dóra Pantó-Naszályi zu Spielfilmen und Nachrichten sowie bei Christiane Bolte-Costabiei und Anja Schümann zu Videoclips von Popsongs.
-------------------------------------------------------------------------------
Möchten Sie weiterlesen? Das aktuelle Heft der Zeitschrift „Fremdsprache Deutsch“ können Sie hier oder in jedem Buchhandel erwerben. Alle Hefte der Zeitschrift finden Sie auch online.
| Der Beiträger/Heftherausgeber |
| Gunther Dietz ist Professor (Vertretung) am Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft / Deutsch als Fremdsprache der Universität Bamberg mit den Arbeitsschwerpunkten Hörverstehen und Korpuslinguistik. Er ist außerdem Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen zur Vermittlung des Hörverstehens. |
Programmbereich: Deutsch als Fremdsprache