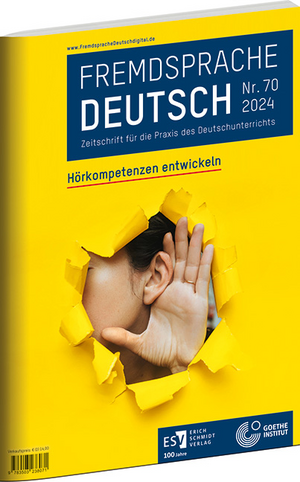„Hörverstehen und Hör-Seh-Verstehen sind immens wichtige Fertigkeiten für das Lernen einer Fremdsprache“
Gunther Dietz: Hörverstehen und Hör-Seh-Verstehen sind immens wichtige Fertigkeiten für das Lernen einer Fremdsprache und natürlich für die Kommunikation generell. Gesprochene oder besser: gehörte Sprache ist – egal ob in der alltäglichen Kommunikation oder in einer Unterrichtssituation – der primäre und am häufigsten genutzte Kanal, über den Lernende die Zielsprache aufnehmen.
Was sind die Herausforderungen für die Lernenden?
Gunther Dietz: Das kann man natürlich nicht pauschal beantworten, aber die Forschung hat einige Teilprozesse des Hörverstehens ermittelt, die für fremdsprachige Hörerinnen und Hörer notorisch schwierig sind. So fällt es Lernenden vor allem zu Beginn des Spracherwerbs schwer, mit dem Tempo von gesprochenen Äußerungen mitzuhalten, das heißt die relevanten Signale im Lautstrom in Echtzeit herauszuhören und zu deuten. Gesprochene Sprache ist flüchtig, Lernende können nicht wie beim Lesen den Lautstrom einfach stoppen oder sich im Gehörten vor- oder zurückzubewegen, wenn sie etwas nicht gleich verstanden haben. Wenn der Wortschatz noch relativ klein ist, dann stoßen Lernende im Lautstrom auf unbekannte Lautsegmente, die das weitere Verstehen beeinträchtigen. Bisweilen kennen Lernende die Wörter sogar „eigentlich“, aber sie erkennen sie nicht in ihrer lautlichen Form im Gehörten, man spricht hier von unzureichendem Hörvokabular.
Auch das Heraushören von grammatischen Informationen ist nicht einfach, weil Wortendungen und sogenannte Funktionswörter wie Präpositionen, Artikel, Konjunktionen akustisch oft unauffällig, das heißt unbetont sind oder weniger deutlich artikuliert werden.
Neben diesen Schwierigkeiten auf der Ebene der Wahrnehmung kann natürlich auch unzureichendes Vorwissen – etwa über kulturspezifische Verhaltensweisen – dazu führen, dass das Gehörte nicht angemessen interpretiert wird.
Die gute Nachricht ist, dass bei entsprechendem Training die meisten dieser Herausforderungen auch gemeistert werden können.
| Auszug aus: „Fremdsprache Deutsch“, Heft 70: Hörkompetenzen entwickeln | 23.04.2024 |
| Das Auge hört mit. | |
 |
Wie hängen Lesen und Hören zusammen? Wie verläuft fremdsprachliches Hören im Gegensatz zum erstsprachlichen Hören? Gibt es Unterschiede? Wie können wir fremdsprachliches Hören sinnvoll in den Unterricht eingliedern und welche didaktischen Möglichkeiten bietet das Hör-Seh-Verstehen? mehr … |
Sind authentische Materialien im Unterricht eine gute Idee?
Gunther Dietz: Unbedingt! Im echten Leben entstandene Interaktionssituationen weisen eine größere Fülle an tatsächlich vorkommenden sprachlichen Merkmalen auf als Hörtexte, die eigens für Lehrwerke produziert werden. Natürlich muss man als Lehrkraft geschickt und kritisch auswählen, welche authentischen Materialien man den eigenen Lernenden zumuten kann. Und man muss die Aufgabenstellungen so konzipieren, dass der Fokus auf ausgewählte, machbare Aspekte des Hörmaterials gelenkt wird. Aber ich denke, dass hier viel mehr möglich ist, als man sich gemeinhin vorstellt, und zwar schon ab dem A-Niveau. Ein paar Vorschläge zum Einsatz authentischer Hörmaterialen finden sich auch im Themenheft.
Was ist mit Musik?
Gunther Dietz: Musik, etwa in Form deutschsprachiger Popsongs, bietet sprachlich reichhaltige und oft inspirierende Anregungen für Lernende. Inhaltlich können Hörerinnen und Hörer durch aktuelle, aber auch durch zeitlose Themen angesprochen werden, auch emotional. Wiederholungen von Songzeilen in Refrains, die deutliche rhythmische Gliederung der Texte sowie die Einbettung in die Sprache der Musik können gleichermaßen motivierend wie verstehensfördernd wirken. Die Lieder der Band ok.danke.tschüss, die im Themenheft vorgestellt werden, sind ein gelungenes Beispiel dafür.
Was ist Mikrohören?
Gunther Dietz: Mikrohören bzw. Mikro-Hörübungen bieten einen zusätzlichen und zum Teil alternativen Zugang zur Erschließung von Hörtexten. Anstatt den Lernenden fast ausschließlich Fragen zum Text zu stellen, wie dies immer noch weitgehend in der Hörverstehensvermittlung praktiziert wird, zielen Mikrohörübungen darauf ab, die Lernenden auf unterschiedlichste Aspekte des lautlichen Inputs aufmerksam zu machen. Dies erfolgt in der Regel an kurzen Sequenzen aus Hörmaterialien, die mehrfach wiederholt werden, um den Hörern und Hörerinnen die Chance zu bieten, die jeweiligen Phänomene wahrzunehmen. So kann es beispielsweise darum gehen, sich nur auf Zahlen zu konzentrieren, die in einem Hörtext vorkommen, oder es sollen in einem Transkript des Hörtextes Pausen markiert werden und im Kurs darüber gesprochen werden, warum der die Sprecher/in jeweils eine Pause macht. Oder Lernende stellen Vermutungen an, wie eine Äußerung, die von der Lehrperson akustisch „abgeschnitten“ präsentiert wird, wohl weitergeht. Oder sie sollen alle gehörten Wörter einer Hörpassage notieren oder auch nur die letzten vier. Da gibt es viele Möglichkeiten, intensiv an der lautlichen Substanz zu arbeiten. In unserem Themenheft werden einige Ideen hierzu vorgestellt.
Meiner Einschätzung nach ist die stärkere Integration von Mikrohör-Übungen in die übliche Fragen-zum-Text-Praxis ein vielversprechender Ansatz für die Hörverstehensvermittlung.
| FD 70: Hörkompetenzen entwickeln | 24.04.2024 |
| Kostenfreie Webinare: Hörkompetenzen entwickeln im Fach DaF/DaZ | |
 |
Zwei kostenfreie Webinare im Mai geben Ihnen einen Eindruck der neuen Ausgabe von Fremdsprache Deutsch! Passend zur aktuellen Ausgabe 70 Hörkompetenzen entwickeln bietet das Goethe-Institut zwei Webinare am 02.05. und 30.05. an. mehr … |
Gibt es in einem Themenheft zu Hörkompetenzen auch etwas zum Anhören?
Gunther Dietz: Es war den Gestalterinnen und Gestaltern des Themenhefts ein großes Anliegen, zu möglichst vielen in den Beiträgen vorgestellten Hör- und Hörseh-Materialien einen direkten, anschaulichen Zugang anzubieten. Insofern ist das Heft voll von Links und QR-Codes, über die man im Idealfall schon beim Lesen die Audios anhören kann.
Was ist Ihr persönlicher Tipp zum Hörverstehen?
Gunther Dietz: Lehrkräften möchte ich empfehlen, in ihren Kursen oder Klassen ab und an auch mal mit authentischen Materialien zu arbeiten – vielleicht auch in Form von Mikro-Hörübungen. Und Lernerinnen und Lerner kann ich nur ans Herz legen, auch außerhalb der Unterrichtssituation jede Gelegenheit zu nutzen, sich dem Klang der gesprochenen deutschen Sprache auszusetzen. Es ist dann vielleicht auch nicht so wichtig, ob es sich um die im Unterricht behandelten Hörtexte, um didaktisierte Hör- und Videoangebote (etwa der Deutschen Welle), um Songtexte oder um frei im Netz oder in Mediatheken zugängliche Audios oder Videos handelt. Hauptsache, das Ohr bekommt ausreichend Input in der Zielsprache
| Der Autor |
| PD Dr. Gunther Dietz studierte und promovierte in Deutsch als Fremdsprache, Philosophie und Slavistik an der LMU München. Er war lange Jahre als DAAD-Lektor und Sprachdozent tätig. Von 2009 bis 2024 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und seine Didaktik der Universität Augsburg. Zurzeit vertritt er die Professur für Deutsche Sprachwissenschaft / Deutsch als Fremdsprache an der Universität Bamberg. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten gehören die fremdsprachliche Hörverstehensvermittlung und die Nutzung von Korpora bzw. von korpuslinguistischen Ansätzen in der DaF-Vermittlungspraxis. |
Programmbereich: Deutsch als Fremdsprache