
„Das Klassische nenne ich das Gesunde, und das Romantische das Kranke“
Inwiefern aber übte die Romantik, deren Zeitraum man gewöhnlich von etwa 1795 bis 1848 ansetzt, einen Einfluss auf die darauffolgende Zeit des Realismus aus, obwohl diese der Romantik so kritisch gegenüberstand?
--------------------------------------------------------------------
„In der Literaturgeschichte wird die Epoche des Realismus auf den Zeitraum 1848 – 1888 datiert, womit sie die Nachfolge der Romantik antritt, die sich ungefähr von 1795 bis 1830/1848 erstreckt. Heute versteht man unter Realismus (lat. Res = Ding) eine Einstellung oder auch eine ästhetische Darstellungsweise, die sich durch Sachlichkeit, Zweckorientierung, Pragmatik auszeichnet: »Denkweise, die sich auf die Wirklichkeit bezieht, Wirklichkeitssinn«, lautet eine exemplarisch knappe Definition im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Zumindest dem Alltagsverständnis nach meint das Stichwort ›Realismus‹ eine Beschränkung auf empirische Tatsachen und tendiert zu festen Gewissheiten. Dass eine präzise Begriffsbestimmung jedoch nicht leichtfällt, beweist der Zwang zur adjektivischen Spezifizierung des jeweils Gemeinten: Wahlweise kommt Realismus in der Kunst als ›bürgerlicher‹, ›sozialistischer‹, ›kapitalistischer‹ oder auch ›poetischer‹ vor. Die Liste ließe sich leicht erweitern. Schon Roman Jakobson weist darauf hin, dass der Realismus-Begriff ein »unendlich dehnbarer Sack« sei, »in dem man alles, was man will, verstauen kann«.
Eine Definitionskonstante des Realismus stellt allerdings seine Abgrenzung von der Romantik dar. Das überschneidet sich mit Alltagserfahrungen, in denen der Realismus-Begriff für Selbstbeschreibungen Verwendung findet: In der Politik ist die Inszenierung als ›Realist‹ beliebt und findet sich oft gepaart mit einer Kritik am Gegner, dem weltferne Romantik unterstellt wird.
| Nachgefragt bei Dr. Felix Schallenberg | 03.05.2024 |
| „Die Romantikkritik war in der Tat allgegenwärtig und bestimmte die Literatur wesentlich mit.“ | |
 |
Heutzutage ist die Romantik en vogue. Die Ausstellungen zum 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich sind beliebt und Tickets sofort ausverkauft. Mit Bildern, die stimmungsvolle Sonnenuntergänge, nebelverhangene Gebirge und Paare an den Kreidefelsen Rügens zeigen, ist Caspar David Friedrich zum berühmtesten Maler der deutschen Romantik geworden. Das war im späten 19. Jahrhundert noch ganz anders: die Epoche der Romantik wurde scharf durch den Realismus kritisiert. Theodor Fontane bezeichnete 1853 in einem Artikel den Realismus als »die Wiedergenesung eines Kranken« und damit als ein klares Gegenmodell zur Romantik. Dennoch übte diese einen großen Einfluss auf den Realismus aus. In einer Studie, die sich mit der Prosa und Lyrik Theodor Storms und Wilhelm Jensens befasst, widmet sich Felix Schallenberg dieser Thematik. Wir haben mit ihm gesprochen. mehr … |
Die beiden Begriffe erfüllen eine rhetorische Funktion, sind häufig vage und suggerieren ungeachtet dessen eine gewisse Selbstverständlichkeit. Im historischen Verlauf steht sich das betreffende Begriffspaar meist unversöhnlich gegenüber und hat sich zu einem zähen Antagonismus entwickelt. Was im heutigen Sprachgebrauch normal wirkt und deshalb oft unauffällig bleibt, hat sich erst allmählich herausgebildet. Mögen ähnlich konnotierte Bezeichnungen wie ›Schwärmer‹ oder ›Idealist‹ auch älter sein: Die Anfänge des oppositionellen Begriffspaars Romantik und Realismus sind in kontrastierenden Epochenverhältnissen des 19. Jahrhunderts zu suchen.
Die Fährte führt insbesondere in die Literaturgeschichte, in der die Romantik früh Kritik erfahren hat: »Das Klassische nenne ich das Gesunde, und das Romantische das Kranke«, lautet ein vielzitierter Satz von Johann W. von Goethe, der noch im gesamten 19. Jahrhundert nachhallt. Während der langen Phase der zweiten Jahrhunderthälfte lässt sich einem Romantikverständnis nachspüren, das oft mit negativen Etiketten versehen ist und in Kontrast zu einem als ›realistisch‹ bezeichneten Literatursystem steht. In einem Gestus der Ablehnung entwirft die Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts kritische Bedeutungsvarianten des Romantischen, die weit bis ins nachfolgende Jahrhundert hineinwirken. Die Literaturgeschichtsschreibung, beispielsweise Georg Gottfried Gervinus’ fünfbändige Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen (1835 – 1842), wertet die Klassik auf und funktionalisiert sie als Gegenfolie einer Romantik, die ihrerseits keine geeignete Grundlage für den Zusammenhalt und Fortschritt der Gesellschaft anbiete.
Als Theodor Fontane in seinem Artikel Über unsere lyrische und epische Poesie seit 1848 aus dem Jahr 1853 einen »Realismus« als »die Wiedergenesung eines Kranken« ausruft, ist damit zugleich ein selbstbewusstes und identitätsstiftendes Gegenmodell zur Romantik angestimmt. Im Kontext dieses Realismus wird die Abwehr einer als ›krank‹, ›gefährlich‹ und ›reaktionär‹ gedeuteten Romantik auf die Spitze getrieben, sodass Rudolf Haym in seiner Romantischen Schule von 1870 schreiben kann: »Im Bewußtsein der Gegenwart erfreut sich das, was man ›romantisch‹ nennt, keinerlei Gunst«. Diese Einschätzung ist von der Forschung oft reproduziert worden, wodurch sich eine dichotome Perspektive verfestigen konnte. Hier setzt die vorliegende Arbeit an, um die literaturhistorische Relation zwischen Romantik und Realismus neu zu befragen.“
| Zum Autor |
| Dr. Felix Schallenberg studierte Kulturpoetik der Literatur und Medien an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Anschließend erfolgte die Promotion sowie eine einjährige Postdoc-Stelle am Graduiertenkolleg „Modell Romantik. Variation – Reichweite – Aktualität“ an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. |
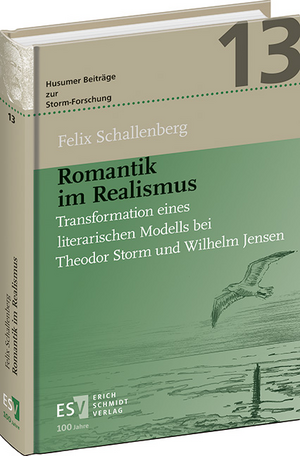 |
Romantik im Realismus von Dr. Felix Schallenberg Verwirrend, weltfremd, krank – die Epoche des Realismus begegnet der Romantik mit scharfer Kritik. Zugleich bleiben romantische Impulse wirksam und üben noch immer einen Einfluss auf den literarischen Realismus aus. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik
