
„Die Romantikkritik war in der Tat allgegenwärtig und bestimmte die Literatur wesentlich mit.“
Lieber Herr Schallenberg, Ihr Buch „Romantik im Realismus“ befasst sich mit zwei Epochen, die schwer voneinander abzugrenzen sind, obwohl sie auf den ersten Blick unterschiedlicher kaum sein könnten. Wie verorten Sie die beiden Epochen in Ihrem Buch?
Felix Schallenberg: In meinem Buch mache ich den Vorschlag, Romantik und Realismus nicht einfach als Gegenteile zu diskutieren, halte zugleich aber an der etablierten Epochengrenze fest. Romantik wird dabei nicht nur als ein Begriff für eine literarisch-kulturelle Strömung angeführt, sondern als ein Modell, das im Realismus auf eine transformierte Weise fortwirkt. Mit Hilfe einer modellhaft konzipierten Romantik lassen sich Texte des Realismus auf romantische Einzelausprägungen in Beziehung setzen, ohne sie in Gänze als ‚romantisch‘ klassifizieren zu müssen.
Im Zentrum Ihres Buchs stehen Texte von Theodor Storm und Wilhelm Jensen. Bitte beschreiben Sie unseren Leserinnen und Lesern, mit welchen Texten der beiden Schriftsteller Sie sich beschäftigen.
Felix Schallenberg: Zunächst handelt es sich um Texte, in denen sich Verbindungen zur Romantik gut nachweisen lassen. Mich interessieren insbesondere solche Texte, die explizit auf romantische Literatur Bezug nehmen oder die auf eine literaturgeschichtlich relevante Weise romantische Merkmale integrieren. Das Korpus umfasst einen verhältnismäßig breiten Zeitraum von den 1850er Jahren bis zur Jahrhundertwende um 1900. Damit das Vorhaben nicht zu weit ausfasert, habe ich mich auf Erzählprosa und Lyrik beschränkt, also auf jene Gattungen, die bereits in der Romantik zentral waren. Ausklammern musste ich das Märchen, das einer eigenen Arbeit bedarf.
Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten und wo Unterschiede zwischen den beiden Autoren Storm und Jensen?
Felix Schallenberg: Die Gemeinsamkeiten sind bereits zu Lebzeiten der Autoren aufgefallen. Den besten Beleg liefert Jensen selbst: Selbstironisch gibt er an, seine erste in Buchform publizierte Erzählung zunächst für eine Geschichte von Storm gehalten zu haben. Tatsächlich sind die Einflüsse nicht zu leugnen, es liegen stilistische und inhaltliche Analogien vor, etwa die Vorliebe für Landschaftsdarstellungen, die Melancholie, religionskritische Äußerungen oder auch die Erzeugung von ‚Stimmungen‘. Ein wichtiger Unterschied besteht in der Wertung der beiden Autoren: Als Berufsschriftsteller haftete Jensen das unrühmliche Label der ‚Vielschreiberei‘ an, Storms vergleichsweise übersichtliches Werk erscheint sorgsamer ausgearbeitet und vermittelt eher den Eindruck des Kostbaren und Bewahrungswürdigen. Neben dieser Wertungsdifferenz ist auf den Altersunterschied hinzuweisen: Jensen ist 20 Jahre jünger als Storm. Er ist, wie mir scheint, von der Romantik noch ein bisschen weiter entfernt; die Texte werden pessimistischer, nehmen mitunter auch Anleihen an Weltanschauungslehren des späteren 19. Jahrhunderts, mit denen sich Storm vermutlich weitaus weniger auseinandergesetzt hat.
| Auszug aus: „Romantik im Realismus. Transformation eines literarischen Modells bei Theodor Storm und Wilhelm Jensen“ | 17.05.2024 |
| „Das Klassische nenne ich das Gesunde, und das Romantische das Kranke“ | |
 |
Die Epoche der Romantik und das Romantische waren über einen langen Zeitraum verpönt. Besonders prägend war dabei die Einschätzung des berühmtesten deutschen Dichters, Johann Wolfgang von Goethe: „Das Klassische nenne ich das Gesunde, und das Romantische das Kranke“. Inwiefern aber übte die Romantik, deren Zeitraum man gewöhnlich von etwa 1795 bis 1848 ansetzt, einen Einfluss auf die darauffolgende Zeit des Realismus aus, obwohl diese der Romantik so kritisch gegenüberstand? mehr … |
Wie hat die romantische Literatur in den nachfolgenden Jahrzehnten fortgewirkt? Es gab über einen langen Zeitraum eine sehr kritische Haltung bzw. Ablehnung gegenüber der Romantik.
Felix Schallenberg: Die Romantikkritik war in der Tat allgegenwärtig und bestimmte die Literatur wesentlich mit. Doch der Realismus ahmt die Wirklichkeit nicht ohne Weiteres nach, sondern hält an einer ästhetischen Überhöhung fest – und dabei kommt es immer wieder zu intertextuellen Auseinandersetzungen mit der Romantik sowie zum Einsatz romantischer Motive, Formen und Ideen. Zu denken wäre an die Faszination für das Märchenhafte, die Lied-Gattung oder an das literarische Interesse für den Aberglauben. In seinem Gedicht Meeresstrand macht Storm Gebrauch von der Liedform, um ein Naturgeheimnis mit musikalischem Feingespür zu evozieren. Hier steht er in der Tradition Joseph von Eichendorffs. Allerdings fallen Storms Gedichte konkreter aus, lassen den Eigenwert der Gegenstände stärker hervortreten und werten die Sinneswahrnehmung gegenüber spekulativen Weltdeutungen auf.
In Ihrer Studie ziehen Sie auch immer wieder Bilder berühmter romantischer Maler heran, unter anderem auch Caspar David Friedrich, dessen 250. Geburtstag dieses Jahr in mehreren Ausstellungen gefeiert wird. Was sagen uns dessen Bilder in diesem Kontext?
Felix Schallenberg: Friedrichs Gemälde gelten heutzutage als Musterbeispiele romantischer Bildlichkeit und können Grundideen der Romantik anschaulich machen. Im Kontext des Realismus ist es interessant, dass die Bilder gar nicht weltfremd sind, sondern ein mimetisches Gerüst aufweisen. Es sind die Dinge der Natur, Städte und Menschen, die diese romantischen Bildwelten bewohnen. Die Bilder haben also zunächst einen Wirklichkeitsbezug und stellen nicht bloß willkürliche Einbildungen eines Künstlersubjekts dar. Gleichzeitig hat Friedrich einen relativ freien Umgang mit den Elementen der Wirklichkeit, er ordnet sie neu an und überformt sie ästhetisch, etwa, indem er mit geometrischen Figuren oder Achsensymmetrien arbeitet. Auf diese Weise erhalten die Bilder eine Ausrichtung auf höhere, abstraktere Ideen. In der Nachfolgeepoche des Realismus hält man an solchen Konstruktionen fest, man lässt die Überformung jedoch weniger deutlich zum Vorschein kommen. Der Realismus neigt zur Verschleierung seiner Gemachtheit, er wertet das Konkrete gegenüber dem Abstrakten auf.
Wir danken Ihnen für dieses aufschlussreiche Interview, lieber Herr Schallenberg.
-----------------------------------------------------------
Wenn das Buch Sie, liebe Leserinnen und Leser, interessiert, können Sie es gern hier bestellen.
| Der Autor |
| Dr. Felix Schallenberg studierte Kulturpoetik der Literatur und Medien an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Anschließend erfolgte die Promotion sowie eine einjährige Postdoc-Stelle am Graduiertenkolleg „Modell Romantik. Variation – Reichweite – Aktualität“ an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. |
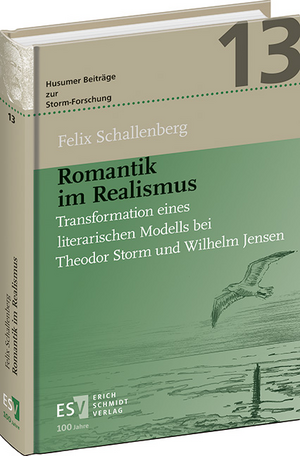 |
Romantik im Realismus von Dr. Felix Schallenberg Verwirrend, weltfremd, krank – die Epoche des Realismus begegnet der Romantik mit scharfer Kritik. Zugleich bleiben romantische Impulse wirksam und üben noch immer einen Einfluss auf den literarischen Realismus aus. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik
