
„Der beste Weg, um eine Sprache zu lernen, ist letztlich etwas sehr Individuelles“
Matthias Schwendemann: Mit dieser Frage sind wir natürlich gleich mittendrin in der Geschichte des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und auch der Zweitspracherwerbsforschung. Trotzdem, oder vielleicht genau deshalb, war genau diese Frage einer der Ausgangspunkte für meine Dissertation. Im Kontext von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache existiert seit vielen Jahren eine reichhaltige und empirische gut begründete Forschungstradition in diesem Bereich. Zahlreiche Forscherinnen und Forscher (etwa die Gruppe um Clahsen, Meisel und Pienemann) haben dabei in den letzten Jahrzehnten eine Theorielinie geprägt, die grundsätzlich davon ausgeht, dass die lernersprachliche Entwicklung im Bereich des Satzbaus im Großen und Ganzen linear und in ganz bestimmten und nicht durch Unterricht beeinflussbaren Sequenzen abläuft, die sich bei allen Lernenden unabhängig von deren Erstsprachen wiederfinden lässt. Es wird davon ausgegangen, dass Lernende beispielsweise zunächst Sätze mit der Reihenfolge Subjekt-Verb-Objekt realisieren können, bevor sie dann Sätze mit voneinander getrennten Verbteilen produzieren können. Danach folgen Sätze, bei denen Lernenden das Vorfeld mit etwas anderem als dem Subjekt besetzen können und danach Nebensätze mit Verbendstellung. Allerdings wurden hier auch immer wieder in verschiedenen Studien Unterschiede in der angenommenen Reihenfolge herausgearbeitet, die nicht immer ganz einfach zu erklären waren.
Grundsätzlichere Kritik erfuhr der Ansatz dabei in den letzten Jahren von Vertreterinnen und Vertretern der Complex Dynamic Systems Theory (CDST), die von einem grundsätzlich komplexen und dynamischen und daher nicht voraussagbaren Verlauf zweitsprachlicher Entwicklung ausgehen und zur Erforschung dieser Entwicklung ein Methodenset vorschlagen, das in der Lage ist, Unterschiede und Brüche, aber auch Diskontinuitäten und vor allem die Variabilität sprachlicher Entwicklung sichtbar und analysierbar zu machen. An diesem Punkt setzt meine Arbeit an, die sich der Annahme eines linear-sequenziellen Zweitspracherwerbs mit Methoden aus dem Spektrum der CDST nähert, etwa mit longitudinalen Clusteranalysen oder Change Point-Analysen, die so bei der Erforschung der Zweitsprache Deutsch noch nicht eingesetzt wurden.
Wie sind Sie in Ihrer Studie vorgegangen?
Matthias Schwendemann: Meine eigene Arbeit war in eine größere Studie zum Zweitspracherwerb erwachsener Lernender mit Erstsprache Arabisch eingebettet, die das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften zusammen mit dem Herder-Institut der Universität Leipzig durchgeführt hat. Aus neurowissenschaftlicher Sicht sollte erforscht werden, inwiefern sich neuronale Strukturen im Gehirn beim Lernen einer neuen Sprache über die Zeit verändern bzw. sich den Anforderungen einer neuen Sprache anpassen.
Um den Zweitspracherwerb im Deutschen und die neuronale Plastizität, also die Tatsache, dass sich auch erwachsene Gehirne noch grundsätzlich verändern können, während der zweitsprachlichen Entwicklung gezielt untersuchen zu können, wurde mit einer Gruppe von über 70 erwachsenen Deutschlernenden mit der Erstsprache Arabisch über 18 Monate ein Intensivsprachkurs durchgeführt, in dessen Rahmen die Lernenden an 5 Tagen pro Woche jeweils 5 Unterrichtseinheiten besuchten. Dabei begannen die Lernenden bei Niveau A1 bzw. ohne Deutschvorkenntnisse und erreichten im Laufe des Sprachkurses etwa das Niveau B2. Es wird schon hier deutlich, welchen großen Umfang diese Studie hatte. Zu manchen Zeitpunkten der Studie wurden die 70 Lernenden von etwa 20 unterschiedlichen Lehrkräften unterrichtet und von zusätzlich bis zu fünf wissenschaftlichen Hilfskräften, die alle gut Arabisch sprachen, unterstützt. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal ganz herzlich bei allen Beteiligten für ihre Unterstützung bedanken, bei den Lehrkräften für ihren außerordentlich guten Unterricht, bei den wissenschaftlichen Assistentinnen und Assistenten für ihre Unterstützung in jeder denkbaren Situation und bei den Lernenden für ihre Bereitschaft, in diesem Umfang und über eine so lange Zeit Deutsch zu lernen.
Im Kontext dieses Sprachkurses wurde eine große Anzahl sehr unterschiedlicher und ungemein spannender Daten erhoben. Einerseits wurden anatomische und funktionelle Gehirnscans mittels MRT- und fMRT-Verfahren durchgeführt, andererseits wurden viele Hintergrunddaten zu den Lernenden erhoben, die es erlauben, einen großen Teil der Voraussetzungen zu rekonstruieren, die die Lernenden mitbrachten, als sie begannen, Deutsch zu lernen. Und zu guter Letzt, und damit sind wir auch bei meiner eigenen Arbeit, wurden über die gesamte Dauer des Sprachkurses mündliche und vor allem schriftliche Lernersprachdaten gesammelt, mit denen die tatsächliche Sprachentwicklung, beispielsweise die Entwicklung des Satzbaus, im Deutschen im Längsschnitt untersucht werden kann.
| Auszug aus: „Die Entwicklung syntaktischer Strukturen“ | 16.06.2023 |
| Syntaktische Strukturen im Zweitspracherwerb | |
 |
Wie passt sich das Gehirn an eine neu zu erlernende Sprache an? Matthias Schwendemann untersucht, wann und in welchen gegenseitigen Abhängigkeiten sich syntaktische Strukturen beim Fremd- und Zweitspracherwerb entwickeln. mehr … |
Warum wurden nur Lernende mit der Erstsprache Arabisch untersucht?
Matthias Schwendemann: Dies hatte einerseits konzeptionelle Gründe, die mit der grundsätzlichen Unterschiedlichkeit der beiden Sprachen zu tun haben. Sie gehören verschiedenen Sprachfamilien an, besitzen unterschiedliche Schriftsysteme und auch die Schreib- und Leserichtung unterscheidet sich zwischen Arabisch und Deutsch.
Andererseits gab es auch praktische Gründe. Die Situation in den Jahren nach 2015 hatte den Effekt, dass eine große Anzahl erwachsener Menschen mit der Erstsprache Arabisch schnell Deutsch lernen wollte bzw. musste. Für die Konzeption der Studie war es wichtig, dass eine Gruppe von Lernenden untersucht wurde, die über einen möglichst homogenen erstsprachlichen Hintergrund verfügte. Daher wurden in der vorliegenden Studie nicht nur einfach Lernenden mit Arabisch als Erstsprache untersucht, sondern aufgrund der grundsätzlich anzunehmenden Diglossie-Situation im arabischen Sprachraum nur Lernende, die aus Ländern der Levante stammen, also Syrien, Libanon, Jordanien oder aus den Palästinensischen Gebieten. Auch hier gibt es natürlich wieder zum Teil deutliche Unterschiede zwischen den Dialekten, aber diese sind wahrscheinlich deutlich geringer als etwa zwischen Lernenden aus Ägypten und Lernenden aus Syrien.
Welche Erkenntnisse haben Sie erlangt?
Matthias Schwendemann: Die in meiner Arbeit verwendeten Methoden geben einen Blick frei auf sprachliche Entwicklung, der es erlaubt, Variabilität, also die Unterschiedlichkeit zwischen verschiedenen Lernenden, aber auch das unterschiedliche Verhalten derselben Lernenden zu unterschiedlichen Zeitpunkten, als konstituierendes Merkmal zweitsprachlicher Entwicklung zu betrachten und nicht als etwas, das im Hintergrund da ist, aber letztlich nur ein Störgeräusch bildet. Sich anzusehen, wann Lernende in dem, was sie mit Sprache tun, besonders viele unterschiedliche Dinge tun, kann dabei helfen zu verstehen, wann bestimmte Entwicklungen einsetzen oder auch zum Erliegen kommen.
In der vorliegenden Studie wurden Lernende in einem ähnlichen Alter, mit ähnlichen Bildungsvoraussetzungen und mit derselben Erstsprache ausgewählt und dennoch ist die Gruppe durch eine sehr große Variabilität in ihren Entwicklungsverläufen geprägt. Gruppen von Lernenden aufgrund eines einzelnen Merkmals (oder auch einer Reihe von Merkmalen) zu bilden, scheint mir daher ein relativ problematisches Vorgehen zu sein, das vielleicht in Zukunft mit einer gewissen Zurückhaltung gehandhabt werden sollte.
Ein ähnliches Feld ist die angenommene Erwerbsreihenfolge im Bereich der Syntax bzw. des Satzbaus. Mit den von mir angewendeten Methoden konnte diese nicht zweifelsfrei aus den vorhandenen Daten rekonstruiert werden. Hier scheint also eine größere Methodenabhängigkeit zu existieren, als das im Fach vielleicht üblicherweise angenommen wird. Wenn das so ist, sollten aber auch Test- und Diagnoseverfahren, die diese angenommenen universellen Erwerbsreihenfolgen operationalisieren und mit potenziellen Konsequenzen für Lernende einhergehen, nur mit großer Vorsicht eingesetzt bzw. sehr gut begründet werden.
Daran anschließend: Können diese zukünftig beim Unterrichten helfen? Sollte etwas anders gemacht werden?
Matthias Schwendemann: Die Erkenntnisse aus meiner Arbeit helfen zunächst wohl nur indirekt beim Unterricht im Kontext von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Für ganz konkrete Transfervorschläge sind sicher weitere Studien nötig. Ich glaube aber, dass die Ergebnisse dieser Arbeit dafür sorgen könnten, einige Konzepte im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache mit etwas mehr Vorsicht zu betrachten und auch mögliche Konsequenzen mitzudenken, etwa dann, wenn es um die angenommene Homogenität von Lerngruppen geht. Besonders bezieht sich diese Vorsicht, die sich aus den Ergebnissen meiner Arbeit ergibt, auf das Postulat einer ‚besseren oder besten Methode, um eine Sprache zu lernen‘. Ich denke, dass wir davon im Moment sehr, sehr weit entfernt sind und dass der beste Weg, um eine Sprache zu lernen, letztlich etwas sehr Individuelles ist. Im Gegenteil sind wir gerade erst dabei, zu verstehen, inwiefern sich unterschiedliche persönliche Voraussetzungen auf die zweitsprachliche Entwicklung auswirken und vor allem, wie diese über die Zeit zusammenwirken.
Gleichzeitig glaube ich, dass viele Lehrkräfte bereits Meisterinnen und Meister im Umgang mit Variabilität und heterogenen Lerngruppen sind, da Unterricht in den allermeisten Fällen anders gar nicht funktionieren könnte. Hier ist die Didaktik im Fach vielleicht in manchen Fällen der Forschung sogar ein wenig voraus.
Was ist ihr ganz persönlicher Tipp zum Sprachenlernen?
Matthias Schwendemann: Ich würde alle Sprachlernende gerne dazu ermutigen, neben den vielen Dingen, die ‚gelernt werden müssen‘, auch immer wieder ganz viele Dinge zu tun, die ihnen einfach nur Spaß machen, z. B. sich Musik in der zu erlernenden Sprache anzuhören und sich eine Lieblingsband zu suchen, Lieblingsserien oder kurze Videos anzusehen oder auch einmal die Übertragung einer Sportveranstaltung in der zu erlernenden Sprache anzusehen. Hier sind bei der Individualisierung der eigenen Lernprozesse der Fantasie allerdings keine Grenzen gesetzt.
Wir bedanken uns für das Interview, lieber Herr Schwendemann.
| Zum Autor |
| Matthias Schwendemann ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Linguistik am Herder-Institut der Universität Leipzig tätig. Zu seinen Forschungs- und Lehrschwerpunkten gehören neben den Bereichen Lexikologie und Wissenschaftssprache der Erwerb und die Entwicklung des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache. |
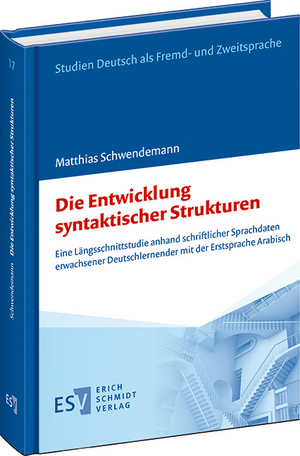 |
Die Entwicklung syntaktischer Strukturen Eine Längsschnittstudie anhand schriftlicher Sprachdaten erwachsener Deutschlernender mit der Erstsprache Arabisch Von Matthias Schwendemann Diese Studie untersucht die Entwicklung syntaktischer Strukturen bei erwachsenen Lernenden des Deutschen als Zweitsprache mit der Erstsprache Arabisch. Hierzu werden schriftliche Daten aus einer longitudinalen Studie verwendet, die über insgesamt 18 Monate am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Kooperation mit dem Herder-Institut der Universität Leipzig durchgeführt wurde. |
Programmbereich: Deutsch als Fremdsprache
