
Syntaktische Strukturen im Zweitspracherwerb
Zur Untersuchung und Auswertung der Gruppendaten werden zunächst Profilanalysen, dann auf deren Basis Emergenzanalysen durchgeführt. Mithilfe longitudinaler Clusteranalysen wird untersucht, ob sich anhand der Komplexitätsmaße Gruppen von Lernenden und typische Entwicklungsverläufe identifizieren lassen. In den Einzelfallanalysen werden neben Profilanalysen Variabilitäts- und Trendanalysen, unterschiedliche Korrelationsanalysen und Change Point-Analysen eingesetzt.
Lesen Sie im Folgenden einen Auszug aus Matthias Schwendemanns Längsschnittstudie:
-----------------
1.1 Problemstellung und Relevanz
Fremd- und zweitsprachliche Erwerbs- bzw. Entwicklungsprozesse werden im deutschsprachigen Fachzusammenhang Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache (DaF/DaZ) seit Jahrzehnten in verschiedenen Kontexten systematisch untersucht (vgl. für einen historischen Abschnitt Ahrenholz 2020b). Bis heute bleiben jedoch Fragen über den Ablauf des Zweitspracherwerbs und seiner Unterschiede zum Erstspracherwerb offen oder werden neu gestellt. Einen zentralen Ausgangspunkt der Zweitspracherwerbsforschung bildet das Interesse daran, den Erwerbsstand grammatischen Wissens der Lernenden zu bestimmten Zeitpunkten während des Erwerbprozesses zu bestimmen. In diesem Zusammenhang soll unter anderem die Frage beantwortet werden, in welcher Weise und Reihenfolge Strukturen erworben werden und welche sprachlichen Funktionen die Lernenden jeweils durch den Erwerb der betroffenen Strukturen realisieren können (vgl. Fandrych 2013). Aus Sicht der Didaktik des Deutschen als Zweit- und Fremdsprache sind diese grundlegenden Fragen eng mit Evaluierung und Weiterentwicklung bestehender Unterrichtsmethoden verbunden.
Viele der stark rezipierten Studien im Kontext DaF/DaZ waren als Einzelfallanalysen konzipiert, die eine geringe Anzahl von Lernerinnen und Lernern sehr genau in ihren Entwicklungen in den Blick nahmen (siehe unten; vgl. Kapitel 2). Dies führte zwar einerseits zu einer sehr detaillierten Modellierung individueller Lernverläufe (vgl. etwa Pienemann 1998; vgl. Czinglar 2014 u. a.), erschwerte aber andererseits mögliche Validierungen der herausgearbeiteten Ergebnisse über die untersuchten Einzelfälle hinaus. Zweitspracherwerbsstudien wurden außerdem oft im vorschulischen oder frühschulischen Bereich durchgeführt. Über erwachsene Lernende existieren hingegen deutlich weniger Daten (vgl. Fandrych 2013:167).
| Nachgefragt bei Matthias Schwendemann | 28.06.2023 |
| „Der beste Weg, um eine Sprache zu lernen, ist letztlich etwas sehr Individuelles“ | |
 |
Wann und wie gewöhnt sich das Gehirn an eine neue Sprache? Ist der Spracherwerb ein individueller oder universeller Prozess? Matthias Schwendemanns <a href="https://www.esv.info/978-3-503-21222-4">Band</a> widmet sich der Frage nach der Entwicklung syntaktischer Strukturen bei Lernenden einer Zweitsprache. Er untersucht die syntaktischen Entwicklungsverläufe erwachsender Lernender mit der Erstsprache Arabisch mithilfe schriftlicher Daten aus einer 18-monatigen longitudinalen Studie. mehr … |
| Das könnte Sie auch interessieren: | 18.03.2021 |
| Welche Erst-Sprachen sprechen Ihre Lernenden? | |
 |
Zungen schnalzen überall anders! Mit dem erweiterten Einzelsprachangebot der kontrastiven Phonetik können Sie die Vermittlung der deutschen Phonetik im DaF-/DaZ-Unterricht nun noch zielgruppenorientierter entlang des sprachlichen Vorwissens Ihrer Lernenden anpassen. mehr … |
Die Grundlage der vorliegenden Untersuchung bilden vor diesem Hintergrund Daten, die zwischen 2016 und 2017 in einer Längsschnittstudie zum Zweitspracherwerb erwachsener Lernender mit Arabisch als Erstsprache am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften (Leipzig) in Kooperation mit dem Herder-Institut der Universität Leipzig erhoben wurden. Die leitende Frage der Studie war, wie sich das Gehirn den Anforderungen einer neu zu lernenden Zweitsprache anpasst, wobei die Plastizität des menschlichen Sprachnetzwerkes und die sich verändernden neuronalen Wechselwirkungen und Verbindungen innerhalb dieses Systems die Kerninteressen der Forschung bildeten. Sowohl aus neurowissenschaftlicher als auch aus der spracherwerbsbezogenen Perspektive von DaF/DaZ spielen syntaktische und semantische Prozesse als Grundfunktionen von Sprache (vgl. Friederici 2013: 250) eine zentrale Rolle im Design der Studie und in der Formulierung der Forschungsfragen (vgl. Kapitel 1.2). Aus der Perspektive des Forschungszusammenhangs DaF/DaZ sind die vorliegende Studie und die in ihrem Rahmen gesammelten Daten aus verschiedenen Gründen aktuell und relevant. Einerseits erlaubt es der Aufbau der Studie, im Längsschnitt über insgesamt 17 Monate hinweg exakte und weitreichende Daten über den Erwerb bzw. die Entwicklung des Deutschen als Zweitsprache zu sammeln. Eine weitere Forschungsperspektive eröffnet sich durch die erstsprachlich homogene Gruppe von Lernerinnen und Lernern, die sich ausschließlich aus Erwachsenen mit der Erstsprache Arabisch zusammensetzt. Die Zielgruppe erwachsener Lernender mit L1 Arabisch wird über die nächsten Jahre für die Didaktik und die Forschung im Kontext von DaF/DaZ eine Lernendengruppe von hohem Stellenwert bleiben. Eine weitere Forschungsebene ergibt sich aus der experimentellen Manipulation innerhalb der Studie, im Rahmen derer die Gruppe der Lernenden in zwei verschiedene Lerngruppen eingeteilt wurde. Eine Studie dieser Größe und Dauer kann wichtige Impulse und Erkenntnisse für die Zweitsprachdidaktik im Bereich der Erwachsenenbildung liefern, die zukünftig in fundierte Diskussionen um die sinnvolle Weiterentwicklung und die empirische Überprüfung von Lehr- und Lernmaterialien und Lehr- und Lernmethoden im Kontext DaF/DaZ überführt werden könnten.
-------------------------
Sie möchten weiterlesen? Den Band können Sie hier über unseren Shop oder über den Buchhandel Ihres Vertrauens beziehen.
| Zum Autor |
| Matthias Schwendemann ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Linguistik am Herder-Institut der Universität Leipzig tätig. Zu seinen Forschungs- und Lehrschwerpunkten gehören neben den Bereichen Lexikologie und Wissenschaftssprache der Erwerb und die Entwicklung des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache. |
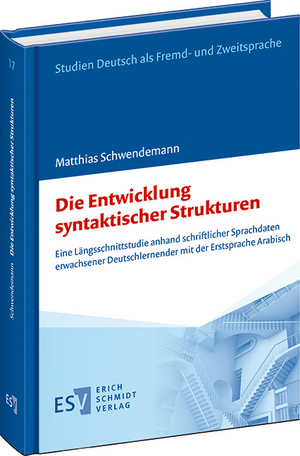 |
Die Entwicklung syntaktischer Strukturen Eine Längsschnittstudie anhand schriftlicher Sprachdaten erwachsener Deutschlernender mit der Erstsprache Arabisch Von Matthias Schwendemann Diese Studie untersucht die Entwicklung syntaktischer Strukturen bei erwachsenen Lernenden des Deutschen als Zweitsprache mit der Erstsprache Arabisch. Hierzu werden schriftliche Daten aus einer longitudinalen Studie verwendet, die über insgesamt 18 Monate am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Kooperation mit dem Herder-Institut der Universität Leipzig durchgeführt wurde. |
Programmbereich: Deutsch als Fremdsprache
