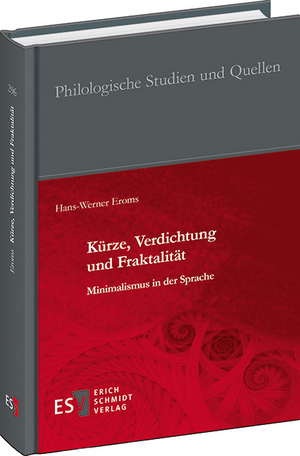Der Wortbildungstyp „K-Frage“ ist ein ausgesprochen virulenter Typ
Verkürzung und Minimalisierung in der Sprache findet in vielen Lebensbereichen statt, die uns täglich begegnen. Einiges ist selbstverständlich geworden: So sprechen wir von der „K-Frage“, fahren E-Bike (oder auch eBike) und nutzen ChatGPT, das uns mit einer kleinen, kurzen, möglichst präzisen Anfrage längere Texte generiert. Aber auch in Malerei und Dichtung lassen sich Verdichtungsstrategien erkennen, die neue Formen der Ausdruckmöglichkeit bieten.
Lesen Sie im Folgenden einen Auszug aus Kapitel 4: Fixierung auf Buchstaben und Buchstabengruppen
-------------------------------------------
4.4 Der Wortbildungstyp „K-Frage“
In das Kapitel der Buchstaben und Buchstabengruppen gehört auch der Wortbildungstyp „K-Frage“. Es ist ein ausgesprochen virulenter Typ, der geradezu wuchernd um sich greift und dessen Wirken auch in verwandten Wortbildungsbereichen festzustellen ist. Dabei handelt es sich um sehr unterschiedliche Bildungen, wie die weiter unten behandelte Beispielliste erkennen lassen wird. Das Kurzwort „K-Frage“ hat einen starken Motivationsschub für die Wortbildung mit Einzelbuchstaben ausgelöst, insbesondere für die Typen D-Day oder E-Commerce. Darauf wird im nächsten Abschnitt eingegangen. Der offenbare Anstoßgeber, der Typ „K-Frage“, ist in Eroms (2002) ausführlicher behandelt worden. Auf den ersten Blick ist die Wortbildung „K-Frage“ ein unauffälliges, sprachökonomisches Phänomen. Mit dem Wort wird der längere Ausdruck „Kanzlerfrage“ vermieden. Als der Ausdruck aufkam, ging es zunächst um die Frage, ob Angela Merkel als Kanzlerkandidatin geeignet sei. Die Verkürzung auf K-Frage vermeidet die direkte Benennung der Kandidatur um dieses Amt. Die Vermeidungsstrategie ist, wie sich im Vergleich mit ähnlichen Wortbildungen zeigen lässt, überhaupt ein wichtiger Gesichtspunkt, der bei der Verwendung dieses Wortes und anderer, ähnlich strukturierter, eine Rolle spielt. Weiter lässt sich erkennen, dass die Zusammenhänge, in denen solche Wörter verwendet werden, häufig einen ironischen, kritischen oder distanzierenden Unterton aufweisen. So in den folgenden Beispielen:
- Von K-Fragen, Nasen und Tante Angela – zwei Betroffene über ein Leben als Namensvetter (Süddeutsche Zeitung 10.1.2002)
- K-Frage: Ausgemerkelt. Das Rennen ist gelaufen. CDU-Chefin Angela Merkel hat offiziell ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur der Union erklärt. (manager magazin 11.1.2002)
- K wie „Kanzler(schaft)“: Die drei möglichen Kanzlerkandidaten der SPD haben vereinbart, den tatsächlichen Kandidaten erst Anfang kommenden Jahres zu küren, gut ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl. Zu spät, finden viele. Die K-Frage dürfe nicht zur Q-Frage werden, mit der sich die SPD noch ein halbes Jahr quälen müsse. (FOC12/JUL.00038 FOCUS, 02.07.2012)
- Kapitän (einer Sportmannschaft): 16 Tage vor dem ersten Vorrundenspiel bei der WM in Südafrika hat der Bundestrainer nach tagelangen Diskussionen seine wichtigsten Personalentscheidungen öffentlich gemacht – und dabei in der T- und K-Frage für keine Überraschungen gesorgt. (M10/MAI.40424 Mannheimer Morgen, 29.05.2010)
- Kitsch: Am Ende eines solchen musikalischen Zeugungsaktes kann „Kitsch in Gestalt misslungener Kunst“ stehen – das lehrt zumindest eine der Lektionen, mit der der Mainzer Musikwissenschaftler Franz-Josef Schwarz und seine Ménage à trois (Sängerin Katja Rommel, Margarete Schurmann-Spengler am E-Piano) unseren Sinn für die K-Frage (ist das nun Kitsch, oder… ?) schärfen. (M10/AUG.58645 Mannheimer Morgen, 21.08.2010)
- Kurzarbeitergeld: Jetzt stellt sich am Arbeitsmarkt wieder die K-Frage: Nachdem die düsteren Konjunkturaussichten auch zunehmend die Statistiken der Nürnberger Bundesagentur trüben, werden Rufe nach einer Verlängerung des Kurzarbeitergeldes immer lauter. (M12/NOV.09642 Mannheimer Morgen, 30.11.2012)
| Nachgefragt bei Prof. Dr. Hans-Werner Eroms | 25.06.2025 |
| „Emojis erweitern das Ausdruckssystem unserer Sprache“ | |
 |
„Weniger ist mehr“ ist sicherlich auf vielerlei Ebenen ein Motto unserer Zeit. In einer Welt der ausufernden Möglichkeiten muss man sich manchmal auf das Wesentliche besinnen, ob nun beim bewussten Aussortieren des Kleiderschranks oder beim Filtern und Bewerten von Informationen. mehr … |
Was die Formseite betrifft, so fällt auf, dass mit dem „K“, wenn damit die Kanzlerschaft gemeint ist, nicht unbedingt auf „Kanzlerschaftskandidatur“ angespielt werden muss, sondern dass es sich auch um „Kanzler“, „Kanzlerin“, „Kanzlerschaft“, „Kandidatur“, „Kanzlerkandidatur“, „Kanzlerinkandidatur“ u. ä. handeln kann. Die genaue Spezifizierung wird offengelassen, ein weiterer kommunikativer Vorteil des Kurzworttyps. Zudem wird damit auch die Genderfestlegung umgangen. Inhaltlich überwiegen die politisch motivierten Belege deutlich. Die Debatte um die Kandidatur für die Kanzlerschaft wird zu einem großen Teil überhaupt nur mit dem Kurzwort geführt. Aber das so häufige Vorkommen im Bereich des Sportes ist doch auffällig und sicher nicht ganz zufällig. Die Analogien zwischen der Führerschaft in der Politik und im Sport mögen dafür den Anstoß gegeben haben. Das Vorkommen in anderen, harmlosen Bereichen ist aber ebenfalls zu registrieren. Weiter fällt auf, dass, wenn schon einmal ein Kurzwort dieses Typs gewählt wird, sich schnell ein weiteres einstellt. In den obigen Beispielen: die „Q-Frage“, die Qualitätsfrage; die „T-Frage“, die Trainerfrage.
Nach der Klassifikation der Kurzwörter von Dorothea Kobler-Trill handelt es sich bei den Wörtern, die einen Einzelbuchstaben als Determinans aufweisen, um unterschiedliche Typen. Kurzwörter mit ikonischer Funktion, wie „S-Kurve“, können von solchen, die „Nummernfunktion“ aufweisen, wie „A-Klasse“ und von Wörtern wie „D-Zug“ unterschieden werden. „D-Zug“ hat ein unklares Basislexem. Ursprünglich bezog sich „Durchgang“ darauf, dass im Zug der Durchgang von Wagen zu Wagen möglich war, später wurde Durchgang als Durchfahrt (ohne Halt), also als „Schnellzug“ aufgefasst. In unserem Zusammenhang ist die Tatsache von Bedeutung, dass mit diesen Kurzwörtern vor allem das gesamte Alphabet ausgeschöpft wird, der genaue semantische Bezug, die Auflösung der Kurzform tritt dahinter zurück.
[...]
Wenn Sie neugierig geworden sind: Sie können das Buch hier bequem bestellen oder aber auch über eine örtliche Buchhandlung beziehen.
| Zum Autor |
| Prof. Dr. Hans-Werner Eroms lehrte bis 2003 als Professor für Deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Passau. Danach hatte er mehrfach Gastprofessuren u. a. in der Slowakei und Ungarn inne. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher und Aufsätze u.a. zur Syntax und Stilistik, sowie zur Öffentlichen Sprache, insbesondere zu stilistisch-pragmatischen Phänomenen wie der Verschränkung von Sprach- und Bildkommunikation. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik