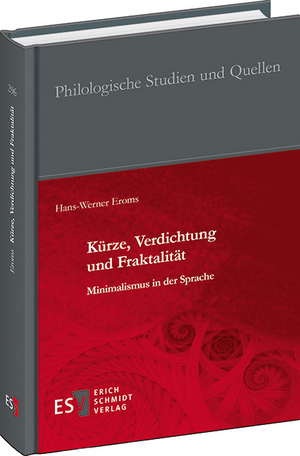„Emojis erweitern das Ausdruckssystem unserer Sprache“
Wir haben mit dem Autor über Minimalismus, Fraktalität und Emoijis gesprochen. Lesen Sie hier unser Interview mit Hans-Werner Eroms.
Lieber Herr Professor Eroms, was bedeutet für Sie Minimalismus?
Hans-Werner Eroms: Minimalismus ist ein mehrdeutiges, ja geradezu paradoxes Phänomen. Einerseits ist es das Bestreben, mit kleinen, mit minimalen Formen so viel wie möglich auszudrücken, sozusagen in eine „Nussschale“ die ganze Welt hineinzupacken. Minimalismus ist in dieser Hinsicht die extreme kompakte Form für möglichst viel Inhalt. Andererseits ist Minimalismus auch Selbstzweck. Das zeigen am besten neuere Kunstströmungen wie Minimal Art, Minimal Music oder in der Architektur die Tiny Houses. Gemeinsam ist allen minimalistischen Strömungen, dass sie Gegengewichte sind gegen die überbordende Fülle von Bildern, Nachrichten, von Informationen jeglicher Art, die in der Moderne die Menschheit bedrängt und bedroht. Verknappung, Beschränkung, Zurückschneidung ist ein Ausgleich dazu, der sich geradezu zwangsläufig entwickeln musste.
Wie kann man diesen auf Sprache beziehen?
Hans-Werner Eroms: Sprache ist immer ein guter Indikator für die Strömungen und Entwicklungen, die sich in der Welt zeigen. So sind etwa die rapide zunehmenden Kurzwörter ein Zeichen für die Tendenz, knappe Formeln für die Dinge der immer unübersichtlicher werdenden Welt zu haben. Der neueste Trend zum sprachlichen Minimalismus zeigt sich in der Projektion ganzer Ideenkomplexe in einen einzelnen Buchstaben: zum Beispiel „die Generation Z“, der gleiche Buchstabe findet sich auch als Siegeszeichen der russischen Invasionstruppen in der Ukraine, die diesen Buchstaben okkupiert haben. Aber auch in harmloseren Fügungen finden sich solche Verdichtungen: „die K-Frage“, „das N-Wort“, wobei gleichzeitig deutlich wird, dass damit Tabuisierungen vorgenommen werden. Überhaupt ist die sprachliche Verdichtung häufig ein Weg, schwierige Dinge auszublenden oder zumindest weniger sichtbar zu machen.
| Auszug aus: „Kürze, Verdichtung und Fraktalität. Minimalismus in der Sprache“ | 20.06.2025 |
| Der Wortbildungstyp „K-Frage“ ist ein ausgesprochen virulenter Typ | |
 |
„Fass Dich kurz!“, ist eine Aufforderung, die manchmal gar nicht so leicht umzusetzen ist. Die Kurzform fällt uns oft schwerer, weil man entscheiden muss, welche Information man auf welche Weise verkürzt wiedergibt, ganz weglässt oder was auch unbedingt bleiben muss. „Verdichtung“ ist notwendig, um im Zeitalter der Informationsflut den Überblick zu behalten. mehr … |
Ihr neues Buch heißt „Kürze, Verdichtung und Fraktalität“. Was verbirgt sich hinter dem Begriff der Fraktalität?
Hans-Werner Eroms: Unter „Fraktalität“ wird das Verhältnis inhaltlich gleicher Einheiten verstanden, die sich nur in ihrer messbaren Größe unterscheiden. Der Begriff stammt aus der Mathematik, genauer aus der Geometrie und ist vor allem von dem Mathematiker Benoît Mandelbrot entwickelt worden. Fraktalität als „Selbstähnlichkeit“ zeigt sich überall, in der Natur, wo etwa Farnblätter unterschiedlicher Größe immer den genau gleichen Bauplan aufweisen, aber auch in kulturellen Bereichen. Die russischen Matrioschkas, die Puppen in der Puppe, führen das sehr schön vor Augen. Fraktalität ist vor allem in der minimalistischen Dimension suggestiv, in der Verkleinerung. So sind Miniaturstädte, Miniatureisenbahnen oder die Bonsaikultur und viele ähnliche Bereiche sehr populär.
Kürze ist oftmals gewünscht, um Inhalte schneller und ohne Umwege zu transportieren. Wie gelingt eine gute Komprimierung von Texten?
Hans-Werner Eroms: Dies ist ein drängendes Problem, das nicht zuletzt die Schule betrifft. Denn die Zusammenfassung eines Textes zeigt, ob Schüler und Schülerinnen diesen in seinen wesentlichen Zügen verstanden haben. Häufig wird dabei ganz auf die Intuition zurückgegriffen: Was wird als das Wesentliche eines Textes verstanden, was kann man bei einer Zusammenfassung weglassen? In der Textlinguistik hat man dazu Verfahren entwickelt, die den Verkürzungsweg kontrollierbar machen, die aber auch sehr aufwendig sind. Neuerdings bieten sich KI-basierte Verfahren an, etwa mit Hilfe der ChatGPT. In meinem Buch gehe ich darauf ein und beleuchte die Reichweite und die sich damit bietenden Möglichkeiten kritisch.
Der heutigen Generation sagt man ja nach, dass sie nur noch die Kurzformen kennt und zu viel zu schnell rezipiert. Ist Kürze nun etwas Gutes oder Schlechtes?
Hans-Werner Eroms: Kürze und Verdichtung sind an sich eher neutral, der Bezug auf die mathematisch definierten Formen der Fraktalität zeigt das ganz deutlich. Aber es ist nicht zu verkennen, dass Kürze, Verkürzung und Komprimierung immer mit Einbußen verbunden sind. Dennoch darf man erwarten, dass in den Kurzformen das Ganze aufzufinden ist. Goethe hat es so formuliert: „Willst du dich am Ganzen erquicken; So mußt du das Ganze im Kleinsten erblicken“ – ein deutliches Plädoyer für die Minimalformen. Und diese verselbstständigen sich, worauf ich oben schon hingedeutet habe. Wer denkt bei Kurzwörtern an die dahinter liegende oft hoch komplexe Begrifflichkeit wie etwa bei „Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland“ oder „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“. Dafür sagt man, ohne auf den Ausgangsbegriff zuzugreifen: ARD oder LASER.
Emojis in Textnachrichten sind inzwischen eigentlich Standard – ebenso, wie der Hashtag fast selbstverständlich zu den oft getippten Tasten gehört. Ist das eine heimliche Erweiterung unseres Buchstabenrepertoires?
Hans-Werner Eroms: Ganz genau! Unser Buchstabenrepertoire reagiert auf die sich ändernde Welt, indem immer mehr graphische und visuelle Zeichen in das Alphabetsystem einwandern. Die Emojis sind sicher die auffälligsten Zeichen. Sie erweitern das Ausdruckssystem unserer Sprache, sie sind Kurzformen für komplexe Begrifflichkeiten und zeigen damit wieder den Trend zur Verdichtung, und sie sind Bildzeichen. Einzelne Zeichenformen ersetzen sogar Wörter, vor allem das Herz als Prädikatausdruck für „lieben“ wie in „Ich ❤️ Hamburg“. Dazu kommt, dass das graphische Zeichensystem übereinzelsprachlich ist; es ist in der ganzen Welt überall gleich und trägt zur Internationalisierung der Kommunikation bei. Es kommt aber noch etwas anderes hinzu: Die normierten Rechtschreibregeln werden mit solchen Formen erweitert oder, wenn man so will, umgangen: So zeigt die Genderdebatte, dass die Verwendungen des Sterns oder des Unterstrichs zur Markierung geschlechtergerechter Ausdrucksweisen auf dem Weg sind, das Schreibrepertoire deutlich zu erweitern. Hochinteressant ist es auch, die Ausweitung der BinnenGroßschreibung genauer zu verfolgen: Waren zunächst in der Werbung Formen wie „BahnCard“, „InterRail“ oder „LaserJet“ zu finden, so ist der Trend, durch Binnengroßschreibung Wortteile generell hervorzuheben, geradezu übermächtig geworden und betrifft weit mehr als die Werbung. Es finden sich sogar quasioffizielle Ausdrücke: „BürgerBüro“, „OpenAir“, „FilmFestival“. In den Minimalformen wird auch versteckter Sinn gesucht. Begonnen hat dies mit der berühmten Werbebotschaft „schreIBMaschinen“, bei dem die Schreibmaschinen mit IBM geradezu synonym gesetzt wurden. Das wuchert heute weiter und führt dazu, dass man Unvermutetes „aufdecken“ kann, wie etwa in „FußbALL“. Schaut man genauer hin, liegen die Wurzeln für diese Sinnmanipulationen dafür viel tiefer. Das Spiel mit Anagrammen und Palindromen hat eine lange Tradition, ebenso die Namenverdrehungen, wenn etwa in Ingeborg Bachmanns Roman „Malina“ eine zentrale Gestalt, „Ivan“, als „naiv“ „erkannt“ wird.
Im Vorwort zu Ihrem neuen Buch sagen Sie, dass Sie sich schon lange mit dem „Verhältnis von ausformulierten gegenüber verdichteten Aussageweisen“ beschäftigen. Wissen Sie noch, welche Fragestellung oder welche Beobachtung genau Sie dazu gebracht hat?
Hans-Werner Eroms: Mein Interesse am Verhältnis von expandierten und verdichteten Formen rührt zunächst von der Beschäftigung mit rein grammatischen Formen her, „Kompaktheit und Streckung“, etwa im Verhältnis von einfachen Verben und Funktionsverbfügungen. Vor allem hat mich die Verdichtung syntaktischer Programme in den verbalen Präfixen besonders interessiert. Aber dann ist mir die allgemeinere Bedeutung von Verdichtung bewusst geworden: In der immer komplizierter werdenden Welt sind die Kurzformen Orientierungshilfen, Bojen, an denen wir uns im Meer des komplexen Universums orientieren können. Unsere sprachlichen Systeme sind in besonderem Maße davon betroffen, und es ist äußerst lohnend, dem genauer nachzugehen.
Lieber Herr Eroms, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben!
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, neugierig geworden sind: Sie können das Buch hier bequem bestellen oder aber auch über eine örtliche Buchhandlung beziehen.
| Zum Autor |
| Prof. Dr. Hans-Werner Eroms lehrte bis 2003 als Professor für Deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Passau. Danach hatte er mehrfach Gastprofessuren u.a. in der Slowakei und Ungarn inne. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher und Aufsätze u.a. zur Syntax und Stilistik, sowie zur Öffentlichen Sprache, insbesondere zu stilistisch-pragmatischen Phänomenen wie der Verschränkung von Sprach- und Bildkommunikation. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik