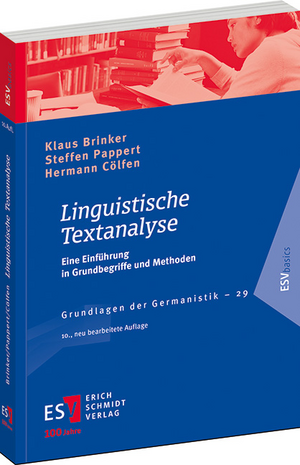Die eigene Textkompetenz stärken
Der Linguistische Textbegriff
Vorbemerkung
In der Textlinguistik gibt es verschiedene Textdefinitionen; eine allgemein akzeptierte Definition liegt bisher nicht vor. Es ist auch fraglich, ob es überhaupt möglich ist, einen allgemein gültigen Textbegriff zu entwickeln, der es erlaubt zu bestimmen, was immer und überall als Text zu gelten hat. Die Gegenstandsbestimmung einer wissenschaftlichen Disziplin ist ja nicht nur durch die Eigenschaften der Objekte (in der Realität) bestimmt, sondern vor allem auch von den jeweiligen Untersuchungszielen der Wissenschaftler/-innen abhängig. Ein absoluter Textbegriff würde dieser Interdependenz zwischen Zielsetzung und Gegenstandsbestimmung beim Aufbau einer Theorie nicht genügend Rechnung tragen. Letztendlich hat man sich in der Textlinguistik damit arrangiert, dass es keinen einheitlichen Textbegriff gibt. Man hat erkannt, dass es ihn nicht geben kann, denn verschiedene Erkenntnisinteressen und Perspektiven führen zwangsläufig zu unterschiedlichen Begriffsbestimmungen. Diese konkurrieren aber nicht in dem Sinne, dass sie sich gegenseitig widerlegen, sondern sie haben je nach Ausrichtung ihre Berechtigung und ihren Nutzen. […] Grob gesehen lassen sich zwei Hauptrichtungen der Textlinguistik unterscheiden, die durchaus unterschiedliche Zielsetzungen entwickelt haben und die ihren Untersuchungsgegenstand „Text“ deshalb auch unterschiedlich definieren.Der Textbegriff der sprachsystematisch ausgerichteten Textlinguistik
Die (auch historisch gesehen) erste Richtung der Textlinguistik entwickelt sich vor dem Hintergrund der strukturalistischen Linguistik und der generativen Transformationsgrammatik. Bei aller Unterschiedlichkeit im Einzelnen definieren diese linguistischen Forschungsrichtungen das Sprachsystem (Langue, Kompetenz) als ihren spezifischen Untersuchungsgegenstand und verstehen darunter den Sprachbesitz einer Gruppe, das einzelsprachliche System von Elementen und Relationen, kurz: das Regelsystem einer Sprache, das der Sprachverwendung (Parole, Performanz) als der theoretisch unendlichen Menge der konkreten Sprech- und Verstehensakte und den durch sie entstandenen sprachlichen Gebilden (Äußerungen, Texten) zugrunde liegt. Die Aufgabe der Linguistik wird darin gesehen, das jeweilige sprachliche System durch Anwendung geeigneter (intersubjektiver) Methoden (Analyseverfahren, Operationen) aufzudecken (strukturalistische Linguistik) bzw. die immanente Sprachkompetenz des idealen, d. h. hinsichtlich der Aspekte der Kommunikation indifferenten Sprecher-Hörers zu beschreiben (generative Transformationsgrammatik).
Innerhalb dieser hier nur ganz allgemein skizzierten linguistischen Richtungen gilt nun jahrzehntelang der „Satz“ als die oberste linguistische Bezugseinheit. Die strukturalistische Linguistik konzentriert sich fast ausschließlich auf die Analyse und Deskription der Struktur des Satzes, vor allem auf die Segmentierung und Klassifikation sprachlicher Einheiten unterhalb der Satzebene (etwa Satzglieder, Morpheme, Phoneme); die generative Transformationsgrammatik definiert ihren Gegenstand, die Sprachkompetenz, als die Fähigkeit des kompetenten Sprechers einer Sprache, eine beliebig große Anzahl von Sätzen zu bilden und zu verstehen, und nimmt dabei selbst die Form eines Regelsystems an, das die (unendliche) Menge von Sätzen einer Sprache „generieren“ soll.
Erst mit dem Entstehen der Textlinguistik Mitte der 60er Jahre kommt es zu einer fundamentalen Kritik an dieser Beschränkung linguistischer Forschung auf die Domäne des Satzes. Es wird geltend gemacht, dass „die oberste und unabhängigste sprachliche Einheit“, „das primäre sprachliche Zeichen“ nicht der „Satz“, sondern der „Text“ sei, linguistische Analyse sich somit stärker als bisher auf den „Text“ zu richten habe. Eine prinzipielle Änderung der geltenden sprachtheoretischen Grundlagen ist mit dieser Forderung allerdings nicht verbunden. Die Textlinguistik versteht sich (wie vorher die „Satzlinguistik“) ausdrücklich als eine Linguistik der „Langue“ (bzw. der „Kompetenz“). Die Hierarchie der bis dahin angenommenen Einheiten des sprachlichen Systems (Phonem, Morphem/Wort, Satzglied, Satz) wird lediglich um die Einheit „Text“ erweitert. Darin drückt sich die Auffassung aus, dass nicht nur die Wort- und Satzbildung, sondern auch die Textbildung (die Textkonstitution) durch das Regelsystem der Sprache gesteuert wird und auf allgemeinen, sprachsystematisch zu erklärenden Gesetzmäßigkeiten gründet.
Die sprachsystematisch orientierte Textlinguistik setzt sich das Ziel, diese allgemeinen Prinzipien herauszufinden und systematisch zu beschreiben. Sie rekurriert dabei sowohl in theoretisch-begrifflicher als auch in methodischer Hinsicht weitgehend auf Bestimmungen der Satzlinguistik strukturalistischer bzw. generativ-transformationeller Provenienz. Dieser Zusammenhang kommt im Textbegriff besonders deutlich zum Ausdruck: „Text“ wird definiert als eine kohärente Folge von Sätzen. Das bedeutet aber, dass der Satz nach wie vor als „Markstein“ in der Hierarchie sprachlicher Einheiten angesehen wird; er gilt als die Struktureinheit des Textes. Die wichtigste Konsequenz dieser Konzeption ist, dass der für die Textlinguistik zentrale Begriff der Textkohärenz rein grammatisch gefasst wird. Er bezeichnet in dieser textlinguistischen Forschungsrichtung ausschließlich die syntaktisch-semantischen Beziehungen zwischen Sätzen bzw. zwischen sprachlichen Elementen (Wörtern, Wortgruppen usw.) in aufeinander folgenden Sätzen. […]
Der Textbegriff der kommunikationsorientierten Textlinguistik
Die zweite (Anfang der 1970er Jahre) entstandene Richtung der Textlinguistik – wir wollen sie „kommunikationsorientierte Textlinguistik“ nennen – wirft der ersten Richtung vor, sie habe ihren Gegenstandsbereich insofern zu sehr idealisiert, als sie Texte als isolierte, statische Objekte behandele und nicht zureichend berücksichtige, dass Texte immer eingebettet sind in eine Kommunikationssituation, dass sie immer in einem konkreten Kommunikationsprozess stehen, in dem Sprecher und Hörer bzw. Autor und Leser mit ihren sozialen und situativen Voraussetzungen und Beziehungen die wichtigsten Faktoren darstellen.
Die kommunikationsorientierte Textlinguistik entwickelt sich vor dem Hintergrund der linguistischen Pragmatik, die die Bedingungen sprachlich-sozialer Verständigung zwischen den Kommunikationspartnern einer bestimmten Kommunikationsgemeinschaft zu beschreiben und zu erklären versucht und sich dabei in sprachtheoretischer Hinsicht vor allem auf die innerhalb der angelsächsischen Sprachphilosophie entwickelte Sprechakttheorie ( J. L. Austin, J. R. Searle) stützt. Unter pragmatischer (sprechakttheoretischer) Perspektive erscheint der Text nicht mehr als grammatisch verknüpfte Satzfolge, sondern als (komplexe) sprachliche Handlung, mit der der Sprecher oder Schreiber eine bestimmte kommunikative Beziehung zum Hörer oder Leser herzustellen versucht. Die kommunikationsorientierte Textlinguistik fragt also nach den Zwecken, zu denen Texte in Kommunikationssituationen eingesetzt werden können und auch tatsächlich eingesetzt werden; kurz: sie untersucht die kommunikative Funktion von Texten. Die kommunikative Funktion legt den Handlungscharakter eines Textes fest; sie bezeichnet – noch ganz vorläufig formuliert – die Art des kommunikativen Kontakts, die der Emittent (d. h. der Sprecher oder Schreiber) mit dem Text dem Rezipienten gegenüber zum Ausdruck bringt (z. B. informierend oder appellierend); erst sie verleiht dem Text also einen bestimmten kommunikativen „Sinn“.
| Nachgefragt bei Professor Dr. Steffen Pappert | 31.07.2024 |
| „Es ist von immenser Bedeutung, etwas über die Struktur und die Funktion von Texten zu erfahren“ | |
 |
Mit Texten müssen wir alle täglich umgehen. Die reine Anzahl von geschriebenen und gelesenen Texten ist in den letzten Jahren, vor allem durch Social Media, stetig gewachsen. Unsere Kommunikation hat sich dadurch sehr verändert: Berufliche E-Mails beispielsweise sind viel kürzer, weniger formell und zielgerichteter als noch vor einigen Jahren. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen besteht die Notwendigkeit, Texte in ihrer Regelhaftigkeit nachvollziehen zu können, um dadurch die eigene Textkompetenz zu steigern. Ein nützliches Grundlagenwerk ist seit vielen Jahrzehnten die „Linguistische Textanalyse“. Lesen Sie hier ein Interview mit dem Autor Professor Dr. Steffen Pappert. mehr … |
[…] Bereits eine flüchtige Vergegenwärtigung des Ablaufs der Textproduktion kann zeigen, dass sowohl die Wahl der sprachlichen Mittel (grammatischer Aspekt) als auch die Entfaltung des Themas bzw. der Themen eines Textes (thematischer Aspekt) kommunikativ gesteuert werden, d. h. durch die kommunikative Intention des Emittenten sowie durch Faktoren der sozialen Situation bestimmt sind, etwa durch den institutionellen Rahmen, durch die Art der Partnerbeziehung (z. B. Rollenverhältnis, Bekanntschaftsgrad), durch die Partnereinschätzung (z. B. Annahmen über Wissen und Wertbasis des Rezipienten) usw.
Entwurf eines integrativen Textbegriffs
Die beiden vorgestellten Grundpositionen der Textlinguistik, der sprachsystematisch ausgerichtete und der kommunikationsorientierte Ansatz, sind nicht als alternative, sondern als komplementäre Konzeptionen zu betrachten und eng aufeinander zu beziehen. Eine adäquate linguistische Textanalyse erfordert die Berücksichtigung beider Forschungsrichtungen, wobei der kommunikativ-pragmatische Ansatz – wie bereits angedeutet wurde – die theoretisch-methodische Bezugsgrundlage bilden muss.
Dieser Auffassung trägt nur ein Textbegriff Rechnung, der es ermöglicht, den Text als eine sprachliche und zugleich kommunikative Einheit zu beschreiben. Die folgende Textdefinition entspricht dieser Bedingung: Der Terminus „Text“ bezeichnet eine von einem Emittenten hervorgebrachte begrenzte Folge von sprachlichen Zeichen, die in sich kohärent ist und die als Ganzes eine erkennbare kommunikative Funktion signalisiert.
[…]
Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Dann bestellen Sie den Band hier.
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik