
Die gemeinsame Erzählwelt der Saarbrücker Prosaepen
Lesen Sie im Folgenden einen Auszug aus dem neu im Erich Schmidt Verlag erschienenen Band Von welsch zu dütsch. Kulturelle und literarische Transferprozesse am Beispiel der Saarbrücker Prosaepen. Darin verdeutlicht die Autorin, dass die narratologische Analyse einer gemeinsamen Erzählwelt sowohl über eine Einzeltextanalyse als auch über eine Untersuchung des nur im Deutschen nachweisbaren Zyklus der vier Texte hinausgehen und Figurenkonstellationen, Raumbeschreibungen und Erzählmotive in einem größeren Erzählverbund betrachtet werden müssen.
Vernetzung von Räumen und Figuren
Erst durch die Verbindung von Figuren und Raum entsteht die Dynamik, die Handlung in der erzählten Welt evoziert. Räume sind damit keine statischen Hintergrundbeschreibungen, sondern stehen als Handlungsmotor in Zusammenhang mit Figurenbewegung, ihrer Erfahrbarkeit von Räumlichkeit oder ihrer Charakterisierung. Da in den Saarbrücker Prosaepen und ihren französischen Vorlagen vor allem das Reisen der Figuren eine zentrale Rolle einnimmt, bietet es sich an, für die Analyse eine topologisch ausgerichtete Perspektive einzunehmen, die das relationale Verhältnis zwischen Raum, Bewegung und Figur zur Prämisse macht. Während manche Figuren an einen bestimmten Ort gebunden sind, zeichnen sich andere durch ihre Mobilität aus. Wie die vorangegangenen Beispiele bereits veranschaulichen, sind es die Protagonist:innen der Texte, die für ihre Abenteuer große Wege zurücklegen. Einen genderspezifischen Unterschied stellt zumeist der Motor der Reise dar. Ist es bei den Männern neben Exilierungen auch die Eigenmotivation wie die Lust nach Abenteuern, die Suche nach der eigenen Familie oder der Wille zum Kampf, nehmen weibliche Figuren in Bezug auf das Reisen eine eher passive Rolle ein und werden wie Sibille von außen zum Ortswechsel gedrängt. Die hochschwangere Herzogin Alheyt wird gemeinsam mit ihrem Mann Herzog Herpin von Karls Hof verbannt und muss, während der Herzog noch auf der Suche nach einer Hebamme ist, allein in einem Wald nahe Florenz ihren Sohn zur Welt bringen. Als sie wenig später von Räubern überfallen, von ihrem Neugeborenen getrennt und beinahe vergewaltigt wird, schlüpft sie schließlich in Männerkleider, um sich vor weiteren Angriffen auf ihre Weiblichkeit zu schützen:
„Sy ginge bij der morder eynen, der dot was, eynen rock sÿ yme vß zoch vnd dede yne ane. Da was sij gecleyt als ein man, eyn swerte gurte sij an yre sijtte.“ (HP 39, 18–21)
Erst das Crossdressing erlaubt ihr eine selbstbestimmte Mobilität in der Erzählwelt, sodass sie an einem Hafen anheuert, in der Hoffnung, ihren Mann in Jerusalem wiederzufinden. Ein Sturm verschlägt die verkleidete Herzogin nach Toledo in Spanien, wo sie unter dem Namen „Besem“ 18 Jahre lang als ‚Küchenjunge‘ am Hof des Königs arbeitet und später sogar das Land von einem Riesen befreit. Nach der Wiedervereinigung mit ihrem Mann nimmt sie schnell wieder ihre Rolle als Herzogin ein und verweilt den Rest ihres Lebens auf einer Burg in Toledo, die ihnen der König zum Dank für ihre Verdienste zur Verfügung stellt:
„Des morgens als es dag was, da namen hertzog Herpin vnd sin husfrouwe vrloup von dem konnige vnd siner dochter vnd rieden bede vff die burg, die yme der konige zu einer wonunge geben haitte. Dar inne hatte der hertzog ein schone kirch gebuwet vnd diente gode flißlich. Er bekomert sich mit den heyden so er aller myneste kunde.“ (HP 515, 14–20)
Das Ehepaar richtet sich ein Leben im Exil ein und arrangiert sich sogar mit den Andersgläubigen. Selbst ihre Ausübung des Christentums wird hier geduldet. Alheyt verweilt von da an – der Genderrolle der Herzogin entsprechend – auf der Burg, solange bis ihr Mann im Kampf fällt und sie schließlich aus Trauer um ihn in ihrem Bett verstirbt:
„Die hertzogyn, die gehielde sich als übel, das sie sich zu stünt zu bethe lacht vnd starb dar nach an dem vierden dage.“ (HP 557, 8–10)
Alheyt kann sich demzufolge nur in ihrer Rolle als Mann frei in der Erzählwelt bewegen. Sobald sie ihre Männerkleidung ablegt und wieder als Herzogin lebt, ist sie in ihrer Mobilität wieder an ihren Mann gebunden, sodass es nur konsequent erscheint, wenn sie kurz nach ihrem Mann zuhause verstirbt. Einzig die Figur der zum Christentum konvertierten Prinzessin Grassien im Herzog Herpin läuft diesem Muster der vertriebenen Frau zuwider. In ihrer partnerschaftlich angelegten, kinderlosen Ehe mit Wilhelm wird sie weder von Nebenbuhlern bedrängt noch in Intrigen verstrickt, sodass sie stattdessen ihren Mann immer wieder aus Gefangenschaften befreien kann. Nach der Organisation der zweiten Befreiungsaktion fasst sie dann aus eigenem Antrieb den pragmatischen Entschluss, ihren Mann stets zu begleiten:
„‚[I]ch wil mit üch rijden, war ir wollent, es sij, wo is sij. Herre‘, sprach Grassien, ‚ich neme nit aller wernde güt, das ir in fremde lande rijdent soldent one mich.‘“ (HP 830, 17–19)
Grassien bleibt die einzige weibliche Figur, deren Mobilität derart selbstbestimmt und ohne (männliche) Verkleidung möglich ist.
[…]
| Nachgefragt bei Dr. Anika Soraya Meißner | 18.03.2024 |
| „Man muss bei der Analyse des umfangreichen Textkorpus aufpassen, nicht in der Erzählwelt verloren zu gehen“ | |
 |
Die Übersetzung der Saarbrücker Prosaepen als Kulturtransferprozess vom französischen in den deutschen Sprach- und Kulturraum stellte eine große Herausforderung dar. Welche Gemeinsamkeiten die jeweiligen Erzählwelten miteinander aufweisen und worin sie sich unterscheiden, kann anhand des Worldbuilding-Modells analysiert werden. Wir haben mit der Autorin Dr. Anika Soraya Meißner gesprochen. mehr … |
Die größte Gruppe der Nebenfiguren in den Saarbrücker Prosaepen bilden jedoch die zahlreichen Adeligen, meist Ritter, die den Protagonist:innen militärische Unterstützung gewähren, sich an den Höfen aufhalten oder zur Gruppe der verräterischen Intriganten gehören. Auffällig dabei ist, dass diese adeligen Figuren immer mit ihrem Herrschaftsgebiet verbunden werden. Besonders wenn es darum geht, die Schlachtaufstellung und die einzelnen Bündnispartner zu nennen, finden sich häufig Aufzählungen verschiedener Fürsten, wie das Beispiel im Huge Scheppel zeigt, in dem Graf Friedrich sein Heer zusammenstellt, um sich für den Tod an seinem Bruder Savary zu rächen:
„So balde ich heyme komen, wellet ir mir dan folgen, so wollen wir vnser geschlechte, mage vnd frunde inn dütschem vnd welschem lande verbotschafften. Den konig von Beheim, den hertzogen von Osterich, Huguon von Vavenise, den hertzogen von Normandye vnd den von Brytanien, den grauen von Anion, von Pouton vnd von Vinaingne, die fürsten alle biß in Hyspanien, hundert tusent man, wollen wir wol vor Parijs brengen, die stat zu beligen.“ (HS 113, 4–12)
Auf diese Weise wird das Geschehen zum einen geografisch eingeordnet, zum anderen zeichnen die Namen in Verbindung mit den Orten auch eine Vorstellung der herrschaftspolitischen Dimension, denn „zahlreiche und bedeutende Verwandte und Verbündete beschreiben zugleich einen weiträumigen Machtbereich,“ so stellt Ute von Bloh fest. Ihr zufolge transportiere diese Konzentration von Eigennamen, Zeit‐ und Ortsangaben die Suggestion von Historizität, da solche vorgeblich exakten Angaben das in den Texten beschriebene, vergangene Geschehen recht genau einordneten und erinnerten. In den vier Prosatexten sind es besonders Orte von herrschaftspolitischer Größe, die häufig vorkommen, so z. B. die Stadt Venedig, die in allen vier Prosaepen, zumindest über die Zuordnung zu einer Figur, eine Rolle spielt. Dass der venezianische Hafen im Mittelalter eine zentrale Position als Brücke zwischen Orient und Okzident einnimmt, spiegelt sich in der Reiseroute des Heeres in der Königin Sibille wider, das auf seinem Weg von Konstantinopel nach Frankreich eben dort einen Zwischenstopp einlegt:
„Der keyser det sin schyffe bereyden vnd synen segel vff richten vnd saß er vnd der babest mit der konnigyn vnd alle yre ritterschafft vnd furen vff dem mere so lange, bis er ghein Venedien kame. Ich sagen uch nit von yren dagereysen, dann sie ridden alvorbaß als lange, das sie in Franckerich kamen.“ (KS 38, 26–32)
Im Herzog Herpin ist Venedig Herrschaftsgebiet und Aufenthaltsort von Rymon, dem Herzog von Venedig und Verbündeten Lewes. In der französischen Vorlage Lion de Bourges wird noch deutlicher, dass es sich mit dieser Ortsnennung um eine Erweiterung des Erzählraumes handelt, die den Text auf räumlicher Ebene mit der Chanson de geste Parise la Duchesse verbindet, deren Haupthandlungsort die Stadt Venedig einnimmt. Anders als im Herzog Herpin wird im Lion de Bourges explizit beschrieben, dass der Herzog von Venedig an einer Stelle in seine eigene Erzählung und damit in sein Land zurückreisen muss und den Protagonisten Lion in der Chanson Lion de Bourges nicht mehr militärisch unterstützen kann. Als Lion dann später selbst nach Venedig reist und den Herzog dort antrifft, wird deutlich, dass sich die beiden Texte dieselbe Erzählwelt, ja sogar dieselbe Landkarte teilen, wenn sie sich trotz ihrer Präsenz in unterschiedlichen Texten an ein und demselben Ort treffen können.
[…]
Vernetzung von Räumen und Handlungsmustern
Die räumliche Struktur der Erzählung schafft Verbindungen zwischen einzelnen Handlungsorten und ermöglicht die Bewegung von Figuren und damit gleichzeitig die Bewegung der Rezipierenden in der erzählten Welt. Oftmals ist die Erzählung deshalb so aufgebaut, dass die Hauptfigur selbst aus einer unbedeutenden Region stammt. Mit ihrer Reise in fremde Regionen werden expositorische Passagen der neu bereisten Orte in die Erzählung eingeflochten, sodass Rezipierende Neues gemeinsam mit der Hauptfigur erkunden können. Für die Saarbrücker Prosaepen lässt sich feststellen, dass alle vier Texte, so unterschiedlich die Motivationen und Reiserouten auch sein mögen, in Frankreich, genauer in Paris beginnen. Dass gerade Paris diese zentrale Position einnimmt, ist wenig verwunderlich, schließlich ist Paris die Residenz Karls des Großen und seiner Nachkommen, einer Dynastie, die das Repertoire der Hauptfiguren maßgeblich bestimmt. So beginnt die Handlung des Herzog Herpin, der Königin Sibille und des Loher und Maller jedes Mal mit der Verbannung der Protagonist:innen aus Paris. Auch die Abenteuerfahrt des Huge Scheppel nimmt ihren Anfang in dieser Stadt, hier zu Beginn jedoch nicht am königlichen Hof, sondern – ganz der bürgerlichen Herkunft des Protagonisten entsprechend – im Stadtzentrum im Haus seines Metzgeronkels Simon, von wo er aus eigenem Antrieb aufbricht, um sich schließlich seinen Weg durch ritterliche Turniere in das französische Königshaus zu bahnen. Erst im zweiten Teil seiner Bewährungsfahrt zum König zieht er von der Residenz in Paris los und ist durch Verrat gezwungen, sich inkognito eine Zeit lang im Exil aufzuhalten, bis er seinen Thron zurückerobern kann.
[…]
Sie sind neugierig, wie es weitergeht? Der Titel erscheint im April 2024 und kann hier vorbestellt werden.
| Zur Autorin |
| Dr. Anika Soraya Meißner studierte Germanistik und Theaterwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum sowie an der ENS Lyon und der Université Lumière Lyon II. Im Masterstudium und während der Promotion wurde sie durch die Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert. Derzeit ist sie Assistentin am Lehrstuhl für deutsche Literatur des Spätmittelalters bei Prof. Dr. Bernd Bastert an der Ruhr-Universität Bochum. |
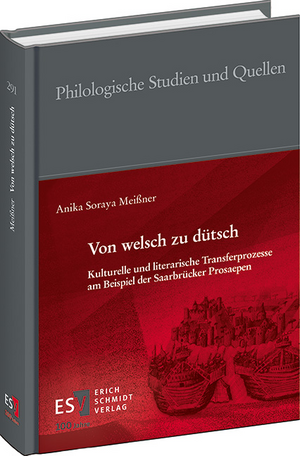 |
Von welsch zu dütsch. Kulturelle und literarische Transferprozesse am Beispiel der Saarbrücker Prosaepen Von Anika Soraya Meißner Die Frage, ob Elisabeth von Nassau-Saarbrücken die Übersetzerin der vier deutschen Prosaepen „Herzog Herpin“, „Königin Sibille“, „Loher und Maller“ und „Huge Scheppel“ aus dem 15. Jahrhundert ist, wurde in der Forschung immer wieder kontrovers diskutiert. Im Zentrum standen dabei lange Zeit übersetzerische Missverständnisse und das Nichtverstehen der Übersetzenden wie Rezipierenden, eine Perspektive, die im Widerspruch zur erfolgreichen Rezeption der Texte im Druck und ihrer jahrelangen Popularität im deutschsprachigen Raum stand. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik
