
„Man muss bei der Analyse des umfangreichen Textkorpus aufpassen, nicht in der Erzählwelt verloren zu gehen“
Anika Soraya Meißner: Die Zielgruppe! Eine Übersetzung ist immer auch abhängig von ihrem (Gebrauchs-)Kontext. Im Fall der Saarbrücker Prosaepen wurden die französischsprachigen Prätexte für ein deutschsprachiges Publikum verstehbar gemacht, indem sie aus ihrem ursprünglich literarhistorischen Kontext gelöst und kulturell neu vernetzt wurden. So konnten die deutschen Übersetzungen auch ohne Kontextwissen der Ursprungskultur gelesen werden, was die Voraussetzungen für eine jahrelange Rezeptionsgeschichte schaffte und eine erfolgreiche Drucklegung überhaupt erst ermöglichte.
Sie schreiben vom Übersetzen nach dem Prinzip „wort ûz wort“ bzw. „sin ûz sin“. Werden das wortgetreue bzw. sinngemäße Verfahren in der Forschung gleichrangig bewertet?
Anika Soraya Meißner: Bereits in der Vormoderne setzte man sich mit unterschiedlichen Übersetzungsverfahren auch theoretisch auseinander und diskutierte insbesondere die Prinzipien „wort ûz wort“ und „sin ûz sîn“ sowie ihre adressat:innenspezifischen Nutzungsmöglichkeiten. Um den vielfältigen Transferleistungen des Mittelalters gerecht zu werden, arbeitet die Forschung heute jedoch mit differenzierteren Begriffen. Dadurch kann die Produktivität von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Übersetzungen, die kürzend, erweiternd, aktualisierend oder dramatisierend in ihre Ausgangstexte eingreifen, spezifischer beschrieben werden.
| Auszug aus: „Von welsch zu dütsch. Kulturelle und literarische Transferprozesse am Beispiel der Saarbrücker Prosaepen“ | 19.03.2024 |
| Die gemeinsame Erzählwelt der Saarbrücker Prosaepen | |
 |
Ist Elisabeth von Nassau-Saarbrücken die Übersetzerin der Saarbrücker Prosaepen? Um dieser Frage nachzugehen, müssen nicht nur die vier deutschen Prosaepen „Herzog Herpin“, „Königin Sibille“, „Loher und Maller“ und „Huge Scheppel“, sondern auch deren französische Vorlagen „Lion de Bourges“, „Reine Sibille“, „Lohier et Malart“ und „Hugues Capet“ miteinander verglichen werden. Dieser französisch-deutsche Kulturtransfer verspricht ein äußerst spannendes Forschungsfeld. mehr … |
Ob die Autorinnenschaft Elisabeths von Nassau-Saarbrücken zweifelsfrei nachweisbar ist, kann in Ihrem Buch nachgelesen werden. Welche Mittel stehen bei der wissenschaftlichen Untersuchung der Saarbrücker Prosaepen zur Verfügung?
Anika Soraya Meißner: Neben den reich bebilderten Hamburg-Wolfenbütteler Prachtcodices, die, nach dem sehr ähnlichen Layout zu urteilen, wohl ursprünglich zusammengehörten, gibt es einige Einzeltextüberlieferungen sowie zahlreiche Drucke bis ins 19. Jahrhundert hinein. In Zusammenhang mit der Arbeit an deutsch-französischen Übersetzungen am Saarbrücker Hof sind zudem die Varsberger Briefe besonders interessant. Diese Korrespondenz umfasst Briefe von und an Elisabeth von Nassau-Saarbrücken in einem Zeitraum von 1432 bis 1434, die von einem Streit über Besitzansprüche der Burg Varsberg handeln.
Inwiefern ist diese Varsberger Korrespondenz von Relevanz?
Anika Soraya Meißner: Anhand der Briefe ist nicht nur belegbar, dass Elisabeth eine eigene Hofkanzlei mit der Erstellung von schriftlichen Korrespondenzen und deutsch-französischen Übersetzungsarbeiten beschäftigte, sondern auch, dass einige von der Forschung bereits als stilistische Eigenheiten herausgestellte Formulierungen sich ebenfalls in den Saarbrücker Prosaepen wiederfinden.
Mit welchen Herausforderungen sahen Sie sich bei der Analyse des Textkorpus konfrontiert?
Anika Soraya Meißner: Das Textkorpus inklusive der französischen Prätexte ist sehr umfangreich. Zudem ist eine gute Kenntnis der französischen Chanson de geste-Literatur notwendig, um intertextuelle Bezüge zu entschlüsseln und die Transferprozesse der deutschsprachigen Übersetzungen erkennen zu können. Gerade das Register an genannten Figuren und Orten ist so groß, dass man aufpassen muss, nicht in der Erzählwelt verloren zu gehen.
Zu guter Letzt: Was haben Der Herr der Ringe, Harry Potter und die Saarbrücker Prosaepen miteinander zu tun?
Anika Soraya Meißner: Alle drei sind für mich gerade deshalb so interessant, weil sie, neben dem eigentlichen Plot, riesige Erzählwelten konstruieren, die dazu einladen, immer wieder neue Geschichten zu erzählen, was ja in Fanfiction und Prequels auch durchaus passiert. Für mich war es erstaunlich herauszufinden, dass die Konstruktion vormoderner Erzählwelten sich dabei gar nicht so sehr von der Konstruktion moderner Erzählwelten unterscheidet.
Vielen Dank für dieses interessante Interview!
| Die Autorin |
| Dr. Anika Soraya Meißner studierte Germanistik und Theaterwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum sowie an der ENS Lyon und der Université Lumière Lyon II. Im Masterstudium und während der Promotion wurde sie durch die Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert. Derzeit ist sie Assistentin am Lehrstuhl für deutsche Literatur des Spätmittelalters bei Prof. Dr. Bernd Bastert an der Ruhr-Universität Bochum. |
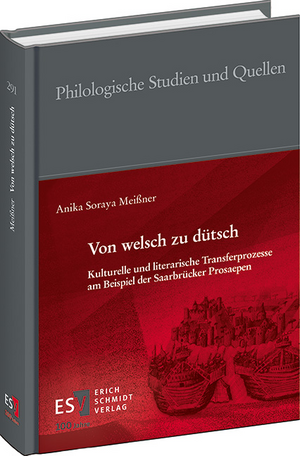 |
Von welsch zu dütsch. Kulturelle und literarische Transferprozesse am Beispiel der Saarbrücker Prosaepen Von Anika Soraya Meißner |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik
