
„Die sittliche Erziehung des Menschen wird zur wichtigsten Aufgabe der Literatur“
Liebe Frau Lepsius, lieber Herr Bach, lieber Herr Vollhardt, Ihr Band versammelt Beiträge, die sich mit der Ausdifferenzierung von Recht und Moral zu Zeiten der Aufklärung beschäftigen – eine vielschichtige rechts- und ideengeschichtliche Entwicklung, die in der Etablierung großer Gesetzeskodifikationen mündete. Doch in welchem Verhältnis standen Recht und Moral vor der Aufklärung?
Susanne Lepsius: In den älteren Epochen wurden Recht und Moral nicht als abstrakte Großbegriffe diskutiert und gegenübergestellt. Vielmehr konnten Fragen, die wir heute als „nur“ ethische Fragen auffassen würden, im forum internum für Katholiken in einer juridischen Form behandelt und einer Sanktion zugeführt werden. Darüber hinaus zeichnet sich der Rechtsbegriff der Vormoderne eher von einem Verständnis eines Rechts aus, das für alle Rechtsgenossen verbindlich ist. Solange nicht geklärt werden musste, ob und ggfs. vor welchem Gericht man diese Rechtsfragen verhandeln und durchsetzen konnte, war die Trennung zwischen (nur moralisch) bindenden Normen und gerichtlich durchsetzbaren Vorschriften deutlich fließender als wir das für das 19. und 20. Jahrhundert sagen würden.
Christian Thomasius, ein zentraler naturrechtlicher Denker und eine Schlüsselfigur Ihres Bandes, unterschied zwischen drei Formen naturrechtlicher Pflichten: iustum, decorum und honestum. Wie würden Sie diese Begriffe umreißen und warum fanden die zwei letzteren Formen der Pflicht keinen Eingang in das gesetzte Recht?
Friedrich Vollhardt: Thomasius kündigt im Titel seines Hauptwerks Fundamenta juris naturae et gentium an, ergänzt aber den Titel, der an das Werk Pufendorfs erinnern soll, durch den Zusatz: in quibus ubique secernuntur principia honesti, justi ac decori – und zwar: ex sensu communi deducta. Die naturrechtliche Pflichtenlehre soll den Forderungen der Gesellschaft nicht allein in der Theorie, vielmehr auch in der Lebenspraxis, auf der Ebene des Umgangs und der sozialen Konventionen angepasst werden, ohne dass der Anspruch auf die Verbindlichkeit der dazu notwendigen Mittel in den unterschiedenen Funktionsbereichen von Iustum, Honestum und Decorum aufgegeben wird. Die officia humanitatis verpflichten den Menschen auch ohne die faktische oder hypothetische Rechtsverwirklichung. Das Funktionssystem des Rechts drängte jedoch mit seiner spezifischen Eigenlogik – einer Logik der Trennschärfe, die Luhmann als ›moralfreie Codierung‹ bezeichnet – auf die Positivierung der regulae iusti, womit die nur sozialgerechten und nicht rechtlich erzwingbaren Verhaltensnormen ihren gleichrangigen Platz im System verlieren sollten.
| Auszug aus: „Zwischen äußerem Zwang und innerer Verpflichtung. Positionen aus Recht und Literatur in der Aufklärung“ | 21.11.2024 |
| „Ich habe Deine Gesetze […] gebrochen, und mein Geist hat sich stets seine Unabhängigkeit bewahrt.“ | |
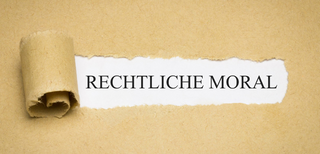 |
Geschriebenes Recht und Gesetze regeln unser gesellschaftliches Miteinander und legen Verhaltensregeln fest. Allerdings sind unsere Handlungen nicht nur durch Gesetze motiviert, sondern auch durch unsere moralischen Vorstellungen und ein Gefühl innerer Verpflichtung. Doch wo hört Moral auf und wo fängt Recht an? Was verbirgt sich hinter diesen großen Begriffen? Welche ideengeschichtlichen Entwicklungen und welches Menschenbild bewirkten ihre zunehmende Trennung während der Aufklärung? mehr … |
Ihr Band beinhaltet Lektüren literarischer Werke, die auch aus rechtsgeschichtlicher Sicht spannend sind. Welche Rolle spielte die Literatur für den rechtsphilosophischen Diskurs während der Aufklärung?
Oliver Bach: Ich möchte das an einem Beispiel aus der Frühaufklärung illustrieren: Nicolaus Hieronymus Gundling, neben Thomasius, Christian Wolff und Johann Peter Ludewig einer der wichtigsten juristischen Professoren in Halle, befasst sich in seiner Vorlesung Über das Natur- und Völkerrecht (postum 1734 erschienen) mit dem Naturzustand des Menschen. Dies war seit Thomas Hobbes und Samuel Pufendorf der state of the art in der Staats- und Naturrechtstheorie: Die fundamentalen, d. h. ohne jede menschliche Setzung gültigen Rechte und Pflichten des Menschen und die Notwendigkeit des Zusammenschlusses zu Gesellschaften und Staaten sollten durch die Vorstellung eines status naturalis erschlossen werden.
Gleichwohl benennt Gundling deutlicher als viele andere ein entscheidendes methodisches Problem: „In statu libertatis leben homines privati heut zu Tage sehr selten“ – d. h. aus empirischer Beobachtung lässt sich dieser Naturzustand, auf dem die Staats- und Naturrechtstheorie doch aufgebaut sein soll, gar nicht erschließen. Pufendorf hatte deshalb 1686 eingeräumt, dass es sich bei seinem Konzept des Naturzustandes um eine Hypothese handelte; und als fictio Pufendorffiana ging sein Naturzustandskonzept schließlich auch in die Theoriegeschichte ein. Gundling macht jedoch etwas anderes: Er empfiehlt seinen Studierenden die Lektüre von Daniel Defoes Robinson Crusoe, „aus welchem einer diesen statum naturalem recht begreiffen kann“.
Defoes Roman begründete gerade im deutschsprachigen Raum einen unvergleichlichen literarischen Trend, in dem neben diversen Übersetzungen vor allem zahlreiche Nachahmer und Adaptionen wie Der Teutsche Robinson, Der Österreichische Robinson, Der Sächsische Robinson, Der geistliche Robinson, Der medicinische Robinson, Robinson der Jüngere u. v. a. m. erschienen. Allein 130 deutsche Robinsonaden zählt die Buchwissenschaft für das 18. Jahrhundert, während es in England und Frankreich jeweils nur ca. 25 sind. Gundling ist sich des Erfolgs von Defoes Roman bewusst und weiß genau, dass er seine Studierenden damit didaktisch „abholt“. Vor allem jedoch schätzt er Robinson Crusoe dafür, der abstrakten rechtstheoretischen Materie eine Anschaulichkeit verliehen zu haben, wie sie in der Empirie gar nicht vorliegt.
Die Antonyme „äußerlich“ und „innerlich“ im Werktitel betonen den Unterschied zwischen rechtlich erzwingbaren und moralisch motivierten Pflichten. Doch sind Recht und Moral einander tatsächlich gegenübergestellt oder gibt es Überschneidungen?
Friedrich Vollhardt: Das Gebot der Humanitätspflichten, das „vornehmlich zu denen Regeln des Anständigen gehöret“ (Thomasius), scheidet im Laufe des 18. Jahrhunderts aus dem Naturrecht aus. Das Decorum erscheint nicht mehr als systematisierungsfähig, seine sozialethischen Gehalte – die officia humanitatis – jedoch als so bedeutsam und aufklärungsbedürftig, dass sie unter Beibehaltung der Semantik von ›Pflicht‹ (gegenüber den anderen) und ›Anstand‹ (den die Gesellschaft fordert) in die systemexternen Gattungen vornehmlich der schönen Literatur übernommen werden, welche die sittliche Erziehung des Menschen zu ihrer wichtigsten Aufgabe erklären.
Abschließend: In welchem Zusammenhang stehen die Verinnerlichung moralischer Pflichten und aufklärerische Ideale wie Verstand, Vernunft und (Selbst-)Bildung?
Friedrich Vollhardt: Wie zuvor bereits angedeutet: Die sittliche Erziehung des Menschen wird zur wichtigsten Aufgabe der Literatur erklärt, die sich in der Ära Kants und Schillers dann mit den genannten Idealen verbinden, die nun transzendentalphilosophisch, nicht länger naturrechtlich begründet werden.
Oliver Bach: Ziel dieser sittlichen Erziehung ist, dass der Mensch sich an die Normen des Rechts ebenso wie der Moral nicht erst deshalb hält, weil sie in irgendeiner Weise sanktioniert sind, sondern bereits aus innerem Antrieb, d. h. aus eigener Überzeugung und Pflichtgefühl. Dies gipfelt sowohl in der Staatstheorie eines Johann Gottlieb Fichte als auch in der utopischen Literatur in der Vorstellung, dass dereinst die Gesellschaft ganz ohne institutionelle Zwangs- und Bestrafungsmaßnahmen funktionieren könne, weil ohnehin alle aus eigenem Pflichtgefühl tun, was sie tun sollen. Wie die Übergangsphase bis zum Erreichen dieses Ziels aussehen soll, wurde in der Aufklärung natürlich vielfach diskutiert: Die gerade erst entstehende bürgerliche Öffentlichkeit war zugleich Forum und Gegenstand dieser Aushandlungsprozesse darüber, wie diese Normen eigentlich beschaffen sein sollen, welche von ihnen fundamental, welche nachrangig seien – z. B. Freiheit oder Wohlfahrt bzw. Gleichheit.
Vielen Dank für dieses interessante Interview!
Wenn Sie mehr über das Spannungsfeld zwischen Pflicht und Moral erfahren möchten, können Sie den Band hier bestellen.
| Über die Herausgeberin und die Herausgeber |
| Prof. Dr. Susanne Lepsius, Professorin für Rechtsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, forscht zum ius commune und zur Praxis der Gerichtsbarkeit; besonderes Augenmerk liegt auf „natura“ als Argument in juristischen Diskursen. Prof. Dr. Friedrich Vollhardt, Professor em. für Neuere Deutsche Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität München, erforscht die Makroepoche der Frühen Neuzeit, die in der Dichtung als Teil einer weit umfassenderen Gelehrtenkultur zu betrachten ist. Dr. Oliver Bach, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der LMU, befasst sich schwerpunktmäßig mit der deutschen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts im Kontext des Rechts- und Staatsdenkens. |
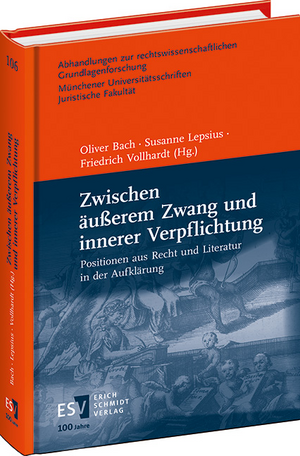 |
Zwischen äußerem Zwang und innerer Verpflichtung. Positionen aus Recht und Literatur in der Aufklärung Herausgegeben von Oliver Bach, Susanne Lepsius und Friedrich Vollhardt Im 18. Jahrhundert erfolgte im naturrechtlichen Diskurs eine ebenso folgenreiche wie vielgestaltige Ausdifferenzierung von Recht und Moral: Sie führte einerseits zu einer Engführung des Rechtsbegriffs auf die mit Hilfe des staatlichen Zwangsapparats durchsetzbaren Rechte. Davon unberührt blieben die sogenannten Anstands- und Sittlichkeitspflichten (‚officia decori‘ bzw. ‚honesti‘) und schieden somit aus dem engeren Rechtsbegriff aus. Dies hatte andererseits zur Folge, dass dem in seinen Zielsetzungen zunehmend frei konzipierten Individuum hohe Ansprüche an Selbstbildung und Erziehung zugeschrieben wurden. Diese Ansprüche ebenso wie die daraus erwachsenden Probleme reflektiert auch die zeitgenössische Dichtung, und zwar vor allem mit Blick auf die Paradoxie von Pflicht und Freiheit sowie auf die Natur des Menschen. Der Band versammelt Studien u. a. zu Samuel Pufendorf, Christian Thomasius, Emer de Vattel, Christoph Martin Wieland, Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller und beleuchtet die Faktoren, die zur Verinnerlichung eines als verbindlich empfundenen Rechtsverständnisses führen sollten. Die für die Aufklärung zentralen Fragen des Anstandes und der Selbstverpflichtung werden aus rechtsphilosophischer wie literaturwissenschaftlicher Sicht in den Mittelpunkt gerückt, wodurch eine Forschungslücke beider Wissensfelder geschlossen wird. |
Programmbereich: Rechtsgeschichte
