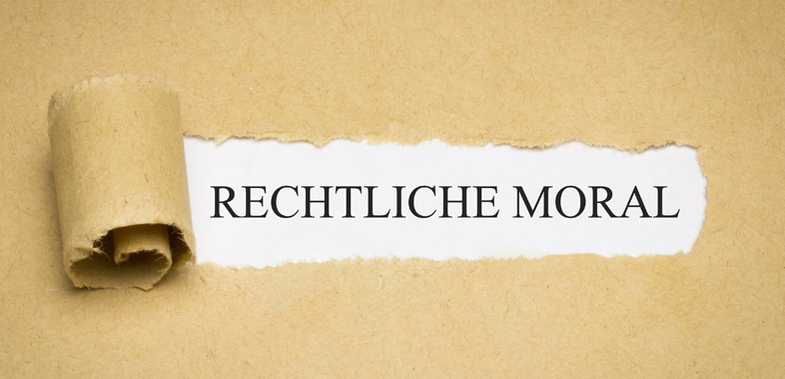
„Ich habe Deine Gesetze […] gebrochen, und mein Geist hat sich stets seine Unabhängigkeit bewahrt.“
Lesen Sie im Folgenden einen Auszug aus dem Band, in dem Gideon Stiening thematisiert, welche rechtlichen Positionen Frauen in der Aufklärung innehatten. In dem Beitrag wird reflektiert, wie sich Naturrecht und essenzialistische Geschlechtervorstellungen zueinander verhalten und wie die Rechtslage der Frau sich entwickelte. Anhand von zwei Literaturbeispielen wird die soziale Ungleichheit beleuchtet, die die Frauenfiguren der Romane von Montesquieu und de Laclos zur Selbstjustiz treibt.
Egalité ou Inégalité? Das Recht der Frau im Zeitalter der Aufklärung
Die gesellschaftliche und politische Stellung der Frau – auch und im Besonderen ihre Stellung im und zum Recht – gehört zu den bedeutenden Kontroversen im Zeitalter der Aufklärung, auch weit vor der Französischen Revolution und den Einsichten Olympe de Gouges’ oder Mary Wollstonecrafts. Nicht zufällig spricht man von – wenngleich unvollständigen und mit vielen Rückschlägen versehenen – Prozessen, die die Frau aus ihrer Stellung als Rechts-Objekt herausführten und zum Subjekt des Rechts erhoben. Auch wenn erst die Französische Revolution – und auch nur für kurze Zeit – eine vollständige rechtliche Gleichheit von Mann und Frau beabsichtigte, fanden weit vorher in Theorie und Praxis Veränderungen statt, die den Weg zu einer Emanzipation der Geschlechter zu ebnen versuchten.
Denn schon in der Frühaufklärung wurde auf der Grundlage einer rationalistischen Anthropologie einerseits eine Egalité des deux sexes nicht allein praktisch postuliert, sondern theoretisch nachgewiesen: „L’esprit n’a pas de sexe“, weil der Geist – wie hier cartesianisch gedacht – gegenüber dem Körper indifferent sei, und es so auch in allen Bereichen der Praxis, einschließlich des Rechts, keinen Grund gebe, einen Unterschied namhaft zu machen. Andererseits wurde – vor allem seit dem frühaufklärerischen Naturrecht – eine Hierarchie der Geschlechter als in der Natur gegründeter und daher mit deren überpositiver Rechtsgeltung ausgestatteter Normativität ausgewiesen; so heißt es in Samuel von Pufendorfs das gesamte Jahrhundert in naturrechtlicher Hinsicht europaweit prägendem ‚De officio‘:
„Quia autem non solum naturali utriusque sexus conditioni maxime congruit, ut in matrimonio, viri conditio sit potior, sed & maritus familiæ, a se utique constitutæ, caput sit.“
Die kontradiktorische Unvereinbarkeit von cartesisch-theoretischer und pufendorfisch-praktischer Anthropologie – beide Texte wurden im gleichen Jahre 1673 publiziert – prägte in unterschiedlicher Weise die spezifisch aufklärerische Variante der Querelle des femmes während des frühen 18. Jahrhunderts. Zweifellos sind einige Formen weiblicher Gelehrsamkeit und deren gesellschaftliche Präsenz – zumindest in den Salons der europäischen Adelskreise – dem Einfluss des Cartesianismus bzw. der rationalistischen Philosophie überhaupt zu verdanken. Noch die Erfolge weiblicher Gelehrsamkeit im Umfeld der beiden Gottscheds im Leipzig der 1730er Jahren ist auf deren Bindung an die Philosophie Christian Wolffs zu beziehen, der in der theoretischen Anthropologie die Voraussetzungen De la Barres teilte und im Rahmen seines auf diese Voraussetzungen gegründeten Naturrechts ausführen kann:
„Folglich ist die Herrschaft im Ehestande (imperium conjugale), welche aus der ehelichen Gesellschaft entspringt, eine beyderseitige Herrschaft der Eheleute über einander.“
Selbst der mit John Lockes Two Treatises of Government wirksame politische Empirismus, der in inhaltlicher Hinsicht vielfach an Pufendorf angelehnt ist, kommt zwar zu dem Ergebnis, eine männliche Herrschaft sei der Natur der Geschlechter geschuldet, doch gibt er auch deren deutliche Grenzen an:
„[I]t therefore being necessary, that the last Determination, i. e. the Rule, should be placed somewhere, it naturally falls to the Man’s share, as the abler and the stronger. But this, reaching but to things of their common Interest and Property; leaves the Wife in the full and free possession of what by Contract is her peculiar Right, and gives the Husband no more power over her Life than she has over his. The Power of the Husband being so far from that of an absolute Monarch, that the Wife has, in many cases, a Liberty to separate from him; where natural Right, or their Contract allows it, whether that Contract be made by themselves in the State of Nature, or by the Customs or Laws of the Country they live in.“
Die Herrschaft des Mannes über die Frau im Rahmen eines Ehevertrages hat hier eher naturgesetzlichen als naturrechtlichen Charakter; und so kommt der Frau auch und gerade naturrechtlich eine Fülle von Rechten zu, die sie vor der unbegrenzten Herrschaft ihres Ehemannes schützt.
Im Hinblick auf die nachfolgenden Überlegungen ist allerdings zu berücksichtigen, dass diese – zumeist philosophischen – Theorieentwürfe die Rechte der Frau nahezu ausschließlich im Zusammenhang des naturrechtlichen Ehe- und Familienrechts abhandeln und dabei – wie gesehen – zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Debattiert wurde noch – und ebenfalls höchst kontrovers – die Frage nach dem Recht der Frau auf Bildung und universitäre Ausbildung sowie die Gründe, Formen und Ausmaße der Strafe von Sittlichkeitsvergehen im Rahmen des Strafrechts; hier ging es zumeist um Prostitution, Ehebruch, Kindsmord u. a.
Die Rechtspraxis sah aber durchaus einen größeren Umfang weiblicher Rechtsfähigkeit vor, und zwar sowohl in privatrechtlicher Hinsicht, so im Erbrecht, das durchaus auch die Übernahme von Firmengeschäften durch eine Witwe vorsah, als auch in öffentlich-rechtlicher Hinsicht, das beispielsweise die Übernahme von Souveränitätsrechten durch Frauen ermöglichte, wie letztlich in strafrechtlicher Hinsicht, das bisweilen drastischer als die theoretischen Überlegungen der Philosophen, bisweilen aber auch zurückhaltender ausfiel. Friedrichs II. relative Milde gegenüber Kindsmörderinnen wurde durchaus nicht von allen Strafrechtlern begrüßt.
Die Rechtspraxis unterschied sich in vielen Teilen Europas also durch das gesamte 18. Jahrhundert hindurch von der Rechtstheorie; auch und gerade in strafrechtlicher Hinsicht war das Zeitalter der Aufklärung durchaus noch kein aufgeklärtes Zeitalter, was keineswegs bedeutet, es habe keinerlei substanzielle Fortschritte in der Rechtsentwicklung des 18. Jahrhunderts gegeben – im Gegenteil sind ab Mitte des Jahrhunderts deutliche Einflüsse der aufklärerischen Theorie auf die Rechtspraxis zu verzeichnen.
| Nachgefragt bei Dr. Oliver Bach, Prof. Dr. Susanne Lepsius und Prof. Dr. Friedrich Vollhardt | 28.11.2024 |
| „Die sittliche Erziehung des Menschen wird zur wichtigsten Aufgabe der Literatur“ | |
 |
Das Deutsche Grundgesetz feierte in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Vor diesem Hintergrund lassen sich Recht, Gesetzgebung und Moral neu reflektieren. Halten wir uns an Gesetze und Normen, weil wir gerichtliche Folgen und Strafen fürchten oder weil wir ein intrinsisches Empfinden für Ethik und Moral haben, nach dem wir handeln? Und wie hat sich unser Verständnis dieser Abstrakta im Laufe der Jahrhunderte entwickelt? mehr … |
Die Grenzen der Aufklärung im Zeitalter der Aufklärung zeigen sich jedoch im Besonderen bei der Frage nach einer sexuellen Selbstbestimmung der Frau, die weder in der Theorie noch in der Praxis des Rechts überhaupt bedacht bzw. berücksichtigt wurde. Vor und außerhalb der Ehe galten sexuelle Handlungen für beide Geschlechter als Unzucht bzw. Ehebruch und wurden mit harten Strafen belegt; innerhalb der Ehe galt die sogenannte Ehepflicht, die eine freie Entscheidung der Frau in sexueller Hinsicht verunmöglichte. Erschwert wurde diese Lage noch durch die seit der frühen Neuzeit verschärften und bis in Zeiten der Spätaufklärung geltenden cura-sexus-Bestimmungen, die jeder, d. h. verheirateten wie unverheirateten Frau eine eigenständige Rechts- oder Geschäftsfähigkeit weitgehend absprach. Vor dem Hintergrund der seit De la Barre wirksamen Egalitätsvorstellungen und -postulaten, die in ihrem Geltungsumfang weit über die Ehe in Gesellschaft und Politik hinausreichten, musste diese Rechtslage zu Widersprüchen führen, die zumeist die einzelnen Frauen auszutragen hatten. Intellektuell zur Gleichheit aufgefordert mussten sie soziale Ungleichheit erleben und ertragen. An eben dieser Stelle setzen sowohl die Lettres persanes als auch die Liaisons dangereuses an, indem sie psychisch und intellektuell autonome, im zweiten Fall gar finanziell unabhängige Frauenfiguren zu Opfern sexueller Übergriffe machen, die rechtlich nicht zu ahnden sind – und daher in einer Art ‚Selbstjustiz‘ gerächt werden. Beide Briefromane, deren formale Anlage es erlaubte, die Frauen selbst als Opfer und als rächende Täterin zu Wort kommen zu lassen, arrangieren die Problemlage allerdings unterschiedlich und finden auch durchaus abweichende Auflösungen.
Ein gewichtiger Grund für die deutlichen Unterschiede beider Romane ist in der folgenden kontextuellen Bedingung gegründet: Die Lage der Querelle und damit die Stellung der Frau in Zeiten der Aufklärung ändert sich europaweit erneut durch das Auftreten Rousseaus und seiner Geschlechtertheorie, die eine grundlegende Differenz zwischen Mann und Frau in deskriptiver und normativer, mithin in natürlicher und moralischer Hinsicht begründet und daraus weitreichende Konsequenzen auch in rechtlicher Hinsicht ableitet. Denn erst Rousseau verschärft die geschlechterpolitische Konfliktlage aus der Perspektive einer – theoretische und praktische Philosophie übergreifenden – Anthropologie, indem er – die christliche Theorie von der ungleichen Natur des Menschen schlicht säkularisierend – den Mann zum anthropologischen Allgemeinen, zum Menschen schlechthin, erhebt, während die Frau im Rahmen einer Sonderanthropologie vor allem als dessen Ergänzung gedacht wird. In ausdrücklicher Zurückweisung der zentralen These De la Barres heißt es im 5. Buch des ‚Émile‘:
„Il n’y a nulle parité entre les deux sexes quant à la conséquence du sexe. Le mâle n’est mâle qu’en certains instants, la femelle est femelle toute sa vie, ou du moins toute sa jeunesse ; tout la rappelle sans cesse à son sexe, &, pour en bien remplir les fonctions, il lui faut une constitution qui s’y rapporte. […] Cette inégalité n’est point une institution humaine ou du moins elle n’est point l’ouvrage du préjugé, mais de la raison : c’est à celui des deux que la nature a chargé du dépôt des enfants d’en répondre à l’autre.“
Die im Selbstverständnis empirische, tatsächlich normativ überlagerte Anthropologie der Spätaufklärung verschärft mithin die Geschlechterproblematik auch in rechtlicher Hinsicht, insofern die Fragen nach dem Recht und den Rechten der Frau auf der Grundlage jener erwähnten physischen Sonderanthropologie erneut zu einer Begrenzung der subjektiven Rechte der Frau und zu deren Re-Objektivierung führen. Erst die Französische Revolution wird im Rahmen einer allgemeinen Gleichheit vor dem Gesetz auch die Rechte der Frau erneut als allgemeiner und gleicher befördern.
Die Literatur des 18. Jahrhunderts hat auf diese konfliktuöse Gemengelage in höchst unterschiedlicher Weise reagiert, die sozialen und rechtlichen Fortschritte bisweilen befördert oder auch massiv behindert. Dabei hat die Literatur – in Ergänzung oder Begrenzung der theoretischen, vor allem philosophischen oder juristischen Debatten – die rechtlich- und politisch-realen Bedingungen, d. h. die positiv-rechtlichen wie die sozialen Realien ebenso berücksichtigt wie die aufklärerische oder auch gegenaufklärerische Theorie. Die europäische Literatur steht mithin zwischen den häufig innovativen rechtsphilosophischen Forderungen und den gegenüber diesem Innovationspotential ebenso häufig weit zurückhängenden Rechtspraktiken, die sie miteinander zu korrelieren sucht.
Im Folgenden soll diese Konfliktlage zwischen den aufklärerischen Forderungen nach einer Rechtsegalität der Frau und der rechtlichen und sozialen Ungleichheit der Frau anhand zweier Briefe aus zwei höchst unterschiedlichen Briefromanen betrachtet werden, nämlich zum einen aus Montesquieus Lettres persanes, die im Jahre 1721 erschienen und deren letzte Ausgabe zu Lebzeiten des Autors 1754 mit einem berühmten Vorwort gedruckt wurden. Zum anderen wird ein Brief aus Choderlos De Laclos’ Roman Liaisons dangereuses zu interpretieren sein, der im Jahre 1782 erstmals publiziert wurde und in den kommenden Jahren eine Fülle von Auflagen erleben sollte – auch und gerade während sowie nach der Revolution. Beide Bände waren also höchst erfolgreiche Romane. Dabei werden die Unterschiede nicht allein durch die immerhin 60 Jahre konstituiert, die beide Textpublikationen trennt, sondern auch und vor allem durch den Sprachstil, die formale Anlage als Briefromane sowie deren Stellung in und zur Aufklärung.
[…]
Sie sind neugierig, wie es weitergeht? Der Titel kann hier bestellt werden.
| Die Herausgeberin und die Herausgeber Susanne Lepsius, Professorin für Rechtsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, forscht zum ius commune und zur Praxis der Gerichtsbarkeit; besonderes Augenmerk liegt auf „natura“ als Argument in juristischen Diskursen. Friedrich Vollhardt, Professor em. für Neuere Deutsche Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität München, erforscht die Makroepoche der Frühen Neuzeit, in der Dichtung als Teil einer weit umfassenderen Gelehrtenkultur zu betrachten ist. Oliver Bach, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der LMU, befasst sich schwerpunktmäßig mit der deutschen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts im Kontext des Rechts- und Staatsdenkens. |
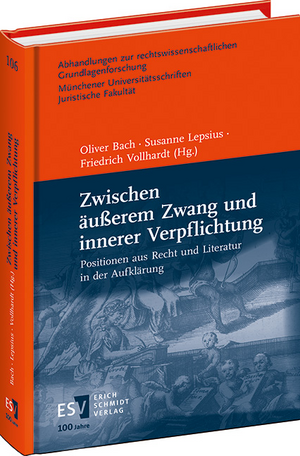 |
Zwischen äußerem Zwang und innerer Verpflichtung. Positionen aus Recht und Literatur in der Aufklärung Herausgegeben von Oliver Bach, Susanne Lepsius und Friedrich Vollhardt
|
Programmbereich: Rechtsgeschichte
