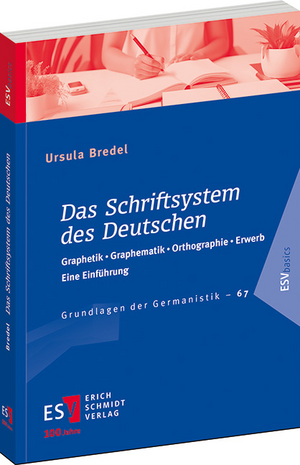„Die zentrale Rolle der Schriftstruktur für das Lesen findet in der Schule praktisch keine Berücksichtigung“
Ursula Bredel: Sehr gern. Die Schrift galt, auch in der Linguistik, lange Zeit als Abbild der gesprochenen Sprache und schien deshalb keiner Analyse wert. Wenn sie überhaupt thematisiert wurde, ging es oft um Normierungsfragen. Im Zentrum stand also die Orthographie, die danach fragt, wie geschrieben werden soll bzw. muss.
In der Weiterentwicklung der Schrifttheorie in den vergangenen ca. 40 Jahren wurde immer deutlicher gesehen, dass dem, was uns in Regelwerken begegnet, normunabhängige Gesetzmäßigkeiten zugrundeliegen. Diese Gesetzmäßigkeiten jenseits von Normen und stattdessen auf der Grundlage des Sprachsystems zu analysieren und zu beschreiben, ist Aufgabe der Graphematik.
Im Optimalfall sollten Graphematik und Orthographie zusammenarbeiten, d.h., die orthographischen Regeln sollten auf gesicherten graphematischen Erkenntnissen aufbauen; dass das nicht immer der Fall ist, greife ich in meinem Buch an verschiedenen Stellen auf, intensiv bei der Getrennt- und Zusammenschreibung, wo System und Norm nicht selten kollidieren.
Die Teildisziplin, die bislang am wenigsten stark ausgebaut ist, ist die Graphetik; sie beschäftigt sich mit der äußeren Form der Schriftzeichen, untersucht also die Gestalt und die Lage schriftsprachlicher Mittel wie Buchstaben oder Interpunktionszeichen. Ist es Zufall, dass alle Vokalbuchstaben „klein“ sind in dem Sinne, dass ihre Körper ausschließlich das Mittelband besetzen, viele Konsonantenbuchstaben aber „groß“ in dem Sinne, dass ihre Körper ins Unterband oder ins Oberband ragen? Ist es Zufall, dass der Gedankenstrich über der Grundlinie schwebt, der Punkt aber auf ihr fixiert ist? In meinem Buch habe ich Konzepte und Theorien zusammengetragen und diskutiert, die Antworten auf solche Fragen suchen.
Das Kapitel zum Erwerb thematisiert die Rolle der Schrifttheorie für die Modellierung und Beschreibung des Schriftspracherwerbs. Dabei geht es zum einen darum, welchen Beitrag die Schrifttheorie bei der Rekonstruktion von Erwerbsfolgen, aber auch bei der Evaluierung von Unterrichtstraditionen leisten kann. Zum anderen geht es darum, Lehr-/Lernmodelle vorzustellen, die nicht auf dem Befolgen von orthographischen Regeln, sondern auf dem Entdecken und Verstehen des Schriftsystems beruhen.
Die Rechtschreibreform von 1996 hat damals zu großen emotionalen und kontrovers geführten Debatten geführt. Einer der besonders umstrittenen Regelbereiche betraf die Getrennt- und Zusammenschreibung. Auch damit beschäftigt sich ein Kapitel Ihres Buchs. Worum geht es?
Ursula Bredel: Die Reformer von 1996 haben einige Normentscheidungen zur Getrennt- und Zusammenschreibung getroffen, die sich, wie oben schon erwähnt, mit dem Schriftsystem, also graphematischen Gesetzmäßigkeiten, nicht vertragen; das betrifft etwa Beispiele wie Kopf stehen (statt kopfstehen), blank putzen (statt blankputzen), schwer behindert (statt schwerbehindert), Besorgnis erregend (statt besorgniserregend).
Beim vieldiskutierten Beispiel kennen lernen hatten die Reformer entschieden, eine Vereinheitlichung bei der Schreibung von Verb+Verb-Verbindungen vorzunehmen, kennen lernen also analog zu tanzen lernen oder schwimmen lernen getrennt zu schreiben. Eine graphematische Analyse ergibt aber schon auf den ersten Blick, dass es sich um sehr verschiedene Fälle handelt. Bei tanzen lernen oder schwimmen lernen sind tanzen bzw. schwimmen Objekte von lernen: Jemand lernt das Tanzen oder das Schwimmen. Bei kennenlernen ist das erkennbar nicht der Fall. Es ist ja nicht so, dass jemand das Kennen lernt.
Die Kritik an dieser Entscheidung war also mehr als berechtigt. Und dass die Getrenntschreibung von kennen lernen in der Sprachgemeinschaft nicht akzeptiert wurde, spricht für eine sehr gute Intuition von kompetenten Schreibern und Schreiberinnen, auch wenn sie nicht erklären können, wann sie wie entscheiden.
In meinem Buch habe ich die graphematischen Gesetzmäßigkeiten, die zu Getrennt- bzw. zur Zusammenschreibung führen, auf der Grundlage der beiden wichtigsten Großstudien von Fuhrhop und Jacobs dargestellt. Die Kriterien können dazu dienen, eigene Schreibentscheidungen zu treffen, Zweifelsfälle zu identifizieren und schließlich Reformentscheidungen nicht nur emotional zu akzeptieren oder abzuweisen, sondern die Akzeptanz oder die Abweisung auch sachlich begründen zu können.
Das Kapitel zur Getrennt- und Zusammenschreibung bietet darüber hinaus eine umfassende Diskussion darüber, was ein sog. graphematisches Wort eigentlich ist, also darüber, was sich zwischen Leerzeichen so alles abspielen kann, und unternimmt einen historischen Streifzug, der die Erfindung und die Entwicklung des Leerzeichens als eines der wirkmächtigsten schriftsprachlichen Mittel beleuchtet.
| Die Geschichte des Leerzeichens | 04.01.2024 |
| „Nichts weiter als ein ‚tintenloser Raum‘“ | |
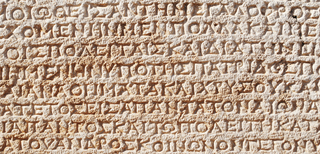 |
Würden wir gefragt, welche Type seit der Erfindung des Buchdrucks auf dem europäischen Kontinent am häufigsten auftritt, würde womöglich das große Rätselraten beginnen. Dabei ist die Antwort ganz einfach: das Leerzeichen. Über eine abwesende Glyphe, die wir alle schätzen sollten und an die trotzdem fast nie jemand denkt. mehr … |
Ein besonderes Merkmal des Deutschen ist die sogenannte satzinterne Großschreibung, die die meisten anderen Schriftsysteme nicht kennen. Dies führt bei Lernerinnen und Lernern immer wieder zu hoher Fehleranfälligkeit. Wie kann man dem in der Didaktik besser vorbeugen?
Ursula Bredel: Im herkömmlichen Unterricht wird die satzinterne Großschreibung an Wortarten gebunden. Es heißt dann, Substantive schreibe man groß. Umgekehrt lernen die Kinder, dass Verben oder Adjektive kleinzuschreiben seien. So praktisch das für den Anfang des Schriftspracherwerbs zu sein scheint, so sehr trägt es zu den Problemen bei, die Sie ansprechen. Denn spätestens dann, wenn Substantivierungen wie das beständige Üben und Desubstantivierungen wie mir wird angst und bange verschriftlicht werden müssen, führt der wortartenbezogene Ansatz in eine Sackgasse. In der weiterführenden Schule müssen erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um die Schüler und Schülerinnen von ihrem jahrelang trainierten Denkmuster abzubringen und zum Umlernen zu bewegen.
Eine graphematisch angemessene Analyse bindet die Großschreibung nicht an Wortarten, sondern an die syntaktische Funktion von Wörtern in Wortgruppen, konkret in Nominalgruppen des Typs der kahle Baum, die kranke Gans, aber auch das beständige Üben oder sein ständiges Vielleicht. Großgeschrieben wird dem syntaktischen Konzept zufolge der Kern der Nominalgruppe, hier also Baum, Gans, Üben und Vielleicht. Es ist sehr gut zu sehen, dass die satzinterne Großschreibung mit der Wortart Substantiv nur wenig zu tun hat; ausschlaggebend ist die Attribuierbarkeit, hier gezeigt an Adjektivattributen (kahle, kranke, beständige, ständiges).
Die Didaktik hat in den vergangenen ca. zwei Jahrzehnten Konzepte entwickelt, die den Erwerb der Großschreibung auf syntaktischer Grundlage modelliert und daraus handhabbare Angebote für den Unterricht entwickelt; zwei davon, das Modell des Treppengedichts von Röber-Siekmeyer und die Attributsprobe von Funke, werden im Buch vorgestellt und diskutiert. Einblicke in empirische Studien können zeigen, zu welchen Lernfortschritten der syntaktische Ansatz führt bzw. führen kann, aber auch, welche Probleme dennoch weiterhin bearbeitet werden müssen. Diskutiert werden außerdem Gründe für das große Beharrungsvermögen, mit dem die Schule trotz aller Misserfolge am traditionellen Konzept des wortartenbasierten Ansatzes festhält.
Die aktuelle PISA-Studie war nicht gerade ermutigend in Bezug auf die Leistungen deutscher Schülerinnen und Schüler. Auch die Lesekompetenz der Jugendlichen hat sich in Deutschland weiter verschlechtert. Wie sieht es im Bereich der Rechtschreibung aus und was sind Ihre Empfehlungen an die Lehrkräfte und die Eltern?
Ursula Bredel: Ca. ein halbes Jahr vor der PISA-Studie ist der IQB-Bildungstrend erschienen, der im Abstand von 5 Jahren die Rechtschreibleistung von Kindern am Ende der 4. Klasse erhebt. Die Ergebnisse sind ebenso niederschmetternd wie die der PISA-Studie: 30,4 % der Kinder erreichten den Mindeststandard in der Rechtschreibung nicht, das waren noch einmal mehr als 2016, wo diese Quote mit 22,1 % schon viel zu hoch war. Studien wie PISA und der IQB-Bildungstrend haben aber einen aus meiner Sicht entscheidenden Webfehler: Sie untersuchen nicht, welche Lernangebote die Schüler und Schülerinnen erhalten haben. Und ein Blick in Deutschbücher für die Schule zeigt, dass an vielen Stellen die falschen Weichen gestellt werden.
In meinem Buch stelle ich dar, welche Folgen es haben kann, wenn Schreib- und Lesenovizen der Schrift nicht als System begegnen und stattdessen viel zu lange auf Laut-Buchstaben-Beziehungen festgelegt werden, die das Schriftsystem erkennbar nicht erfassen. Würden die Kinder von Beginn an lernen, bei der Identifizierung von Buchstabenwerten den Kontext zu berücksichtigen, in dem sie auftreten (Silben, Füße, Stämme, Wörter), wäre der Weg in die Schrift sachangemessen geebnet. Das Buch stellt Modelle vor, die diesen Weg beschreiten.
Leider stellt der traditionelle Unterricht aber nicht nur in Bezug auf die Buchstabentheorie die falschen Weichen, sondern auch bei der Ermittlung weiterer Gesetzmäßigkeiten der Schrift; die Getrennt- und Zusammenschreibung wird so gut wie gar nicht berücksichtigt, die Großschreibung wird, wie oben dargestellt, sachlich falsch an die Wortart Substantiv geknüpft; bei der Interpunktion geht es fast ausschließlich um das Komma, das zudem häufig unsachgemäß modelliert wird. Die zentrale Rolle der Schriftstruktur für das Lesen findet in der Schule praktisch keine Berücksichtigung.
In meinem Buch habe ich die aus fachlicher Sicht problematischsten Aspekte herkömmlicher Unterrichtskonzepte dargestellt und auf der Basis sprachtheoretisch fundierter Konzepte und empirischer Befunde Alternativen vorgestellt.
Meine Empfehlung an die Lehrkräfte ginge dahin, sich mit systemadäquaten Schrifttheorien und Schrifterwerbstheorien bekanntzumachen und sich von den entsprechenden Konzepten inspirieren zu lassen. Eltern können ihre Kinder mit Vorlesesequenzen und dem Austausch über das Gelesene unterstützen. Denn so wichtig die Schriftstruktur, von der mein Buch überwiegend handelt, für den Auf- und Ausbau der schriftsprachlichen Kompetenz ist, so zentral ist die Schriftkultur, konkret, dass Kinder und Jugendliche schriftsprachliche Kommunikation als subjektiv und sozial bedeutsam erfahren.
An welche Zielgruppe haben Sie vor allem gedacht, als Sie das Buch geschrieben haben?
Ursula Bredel: Ich hatte drei verschiedene Zielgruppen im Sinn: Die erste waren die Studierenden, die sich auf den Lehrerberuf vorbereiten; das Erwerbskapitel ist deshalb auch besonders umfangreich geworden, und es ist so angelegt, dass sichtbar wird, wie die Schrifttheorie dazu beitragen kann, Lernsequenzen zu planen, Lernerträge einzuschätzen und Lehr-/Lernmodelle zu evaluieren.
Die zweite Zielgruppe waren Lehrende an Hochschulen, die Veranstaltungen anbieten, in denen die Schrift und die Schrifttheorie thematisch werden. Das Buch ist deshalb so angelegt, dass verschiedene Theorien bzw. Theoriefamilien zur Erfassung der zentralen Phänomenbereiche (Wortschreibung, Großschreibung, Getrennt-/Zusammenschreibung, Interpunktion) auch in ihrer Genese dargestellt und vergleichend gegenübergestellt werden.
Drittens wendet sich das Buch an diejenigen, die Interesse an der Weiterentwicklung der Schriftforschung haben, weshalb es auch Hinweise auf Forschungsdesiderate gibt. Wenn die ein oder andere Fragestellung aufgegriffen und einer Bearbeitung zugeführt werden würde, wäre viel erreicht.
Wir danken Ihnen für dieses aufschlussreiche Interview, liebe Frau Bredel, und wünschen Ihrem Buch viele Leserinnen und Leser.
| Die Autorin |
| Prof. Dr. Ursula Bredel ist Professorin für deutsche Sprache und ihre Didaktik in Hildesheim. Sie forscht und lehrt seit über 25 Jahren zur Schrift- und zur Schrifterwerbstheorie. Bekannt geworden sind vor allem ihre Arbeiten zum Interpunktionssystem des Deutschen sowie ihre Modelle zum Erwerb der Wortschreibung. Als Mitglied des Rats für deutsche Rechtschreibung trägt sie zur Weiterentwicklung der Kodifizierung der deutschen Orthographie bei. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik