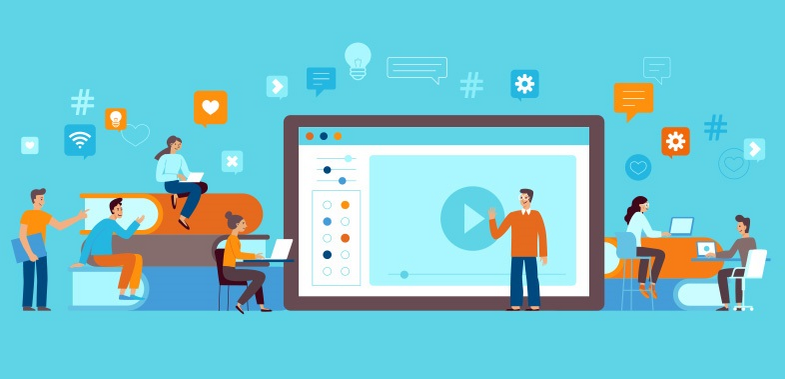
Digitaler Wandel im DaF/DaZ-Unterricht
Einführung
Die massiven gesellschaftspolitischen Veränderungen der letzten zehn Jahre, sei es die weltweite Covid-19-Pandemie, das Aufkommen von Verschwörungstheorien und Fake News in (medialen) gesellschaftlichen Diskursen sowie die durch Kriege, Hungersnöte und die Klimakrise anhaltende Fluchtmigration, um nur einige der dramatischsten Entwicklungen zu nennen, prägen zweifelsohne auch den Forschungsdiskurs im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Damit in Wechselwirkung steht die kontinuierliche Weiterentwicklung von digitalen Technologien und Kommunikationsformen, welche im gegenwärtigen digitalen Zeitalter die meisten Lebensbereiche durchdrungen haben und mit der zunehmenden Ausbreitung von Künstlicher Intelligenz eine Zeitenwende ankündigen. […]
Auch im Fach DaFZ hat die digitale Wende (digital turn) die Forschungslandschaft und Unterrichtspraxis weltweit nachhaltig verändert (vgl. auch Fandrych 2019, Schramm 2019). Eine epochale Zäsur stellte dabei die Covid-19-Pandemie dar, während der sich digitale Technologien nicht mehr nur als innovative Alternative zu herkömmlichen Vorgehensweisen, sondern als unabkömmlich für die Kommunikations-, Lehr- und Forschungspraxis erwiesen. […]
Digitale Lehr- und Lernressourcen
[…]
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass in digitalen Communities tatsächlich jede / r durch user-generated content zum Lehrmaterialproduzierenden werden kann, z. B. mittels leicht zugänglicher Social Media-Plattformen, die oft durch Werbung monetarisiert werden und damit klickzahlgenerierenden Darstellungsformen unterliegen. Chowchong (2022) belegt entsprechend in einer soziolinguistischen Studie von fünf YouTube-Kanälen zum Deutschlernen, wie Spracheinstellungen und -ideologien transportiert werden und Produzierende sich ihrem Publikum gegenüber als Lehrende und Muttersprachler:innen positionieren sowie in den Kommentarspalten in laienlinguistischen Diskursen deren sprachliche Autorität ausgehandelt wird.
Diese Entwicklungen erlauben einen bottom-up-Zugang zu Sprache und ihren Varietäten jenseits der Lehrwerknormen, bergen aber die Gefahr, dass insbesondere kostenlose oder niedrigpreisige, nicht durch eine fachlich versierte Instanz lektorierte Ressourcen einseitig, unvollständig oder fehlerhaft sind oder nur Ausschnitte von umfassenderen Lerngegenständen und Progressionsverläufen abbilden. Lernende, aber auch Lehrende nutzen den virtuellen Raum dennoch zunehmend, um schnell und kostenlos digitale Materialien zu finden oder sich Empfehlungen in der Community geben zu lassen, wie Dvorecký (2023) in einer Studie zu Material-Bedürfnissen einer Facebook-Gruppe für DaF-Lehrende belegt. Materialsuchende müssen aber die Zeit aufwenden (und fachlich in der Lage sein), die frei zur Verfügung stehenden Ressourcen auf Korrektheit sowie auf die Passung zum jeweiligen Lernkontext hin zu überprüfen: Hohe Klickzahlen garantieren keine hohe Angebotsqualität. […]
| Nachgefragt bei Prof. Dr. Hans-Werner Huneke und Prof. Dr. Wolfgang Steinig | 24.08.2022 |
| „Mit Angeboten zum digitalen Fernunterricht während der Pandemie hat sich der Umgang mit Computer und Internet deutlich verändert“ | |
 |
„Wenn es um deutsche Sprache im Unterricht geht, ist man mit einer besonderen Fragestellung konfrontiert: Man glaubt, seine Sprache zu kennen, denn Sprache ist das Medium, in dem wir uns ständig bewegen. Wir sind mit ihr so vertraut wie ein Fisch mit dem Wasser. Aber genau deshalb ist es nicht leicht, sich auf Sprache bewusst einzulassen und sich mit ihr kritisch auseinanderzusetzen“, schreiben Wolfgang Steinig und Hans-Werner Huneke in ihrem Buch „Sprachdidaktik Deutsch“, das in diesem Monat in der 6. Auflage im Erich Schmidt Verlag erscheint. mehr … |
(Sprachlern-)Apps
Digitale Ressourcen, die spezifisch für das (oft selbstgesteuerte) Sprachenlernen entwickelt oder adaptiert wurden, wurden im Bereich DaFZ erst vergleichsweise wenig erforscht. Eine vergleichende evaluierende Untersuchung der Apps Duolingo, Babbel und Busuu in Bezug auf die Vermittlung interkultureller Kompetenz kommt zu dem Befund, dass sich diese auf in Lektionen integrierte oder separate Erklärungen von landeskundlichen Inhalten (alltagsnahes Fachwissen) beschränkt (Fierus 2021).
Zudem werden nur in den Apps Babbel und Busuu der DACH-Ansatz berücksichtigt, authentische, lebensnahe Dialoge (bei Babbel auch critical incidents) integriert sowie durch Fotos und Videos Realitätsnähe hergestellt. Da außerdem keine der Apps Anlass für eine Selbstreflexion böte, wurde gefolgert, dass sich diese nur bedingt zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenz eigneten. Eine umfassende mehrmethodische Langzeitstudie zu Lernhandlungen und -verhalten liegt für die App Duolingo vor (Bui 2022). Für die 16 vietnamesischen DaF-Lernenden wurden vier verschiedene Lernwege beim Umgang mit dem Programm, den Grammatikerklärungen und den Übungen herausgearbeitet, die mit unterschiedlichen Lernformen einhergehen und so zu mehr oder weniger Lerngelegenheiten führten. Für die Programmgestaltung konnten die von Fierus (2021) ermittelten Defizite der App bestätigt und um neue Aspekte wie z. B. das limitierte Aussprachefeedback erweitert sowie durch die Beschreibung kompensatorischer Lernhandlungen in Ergänzung zur Softwarenutzung für konkrete Anwendungssituationen kontextualisiert werden.
Weiterhin identifizierte Bui (ebd.). Einflussfaktoren auf technischer, sozial-kontextueller, personaler und didaktischer Ebene, die zum Unterbrechen, dem Abbruch oder (bei fünf Teilnehmenden) der Weiternutzung der App über den fünfmonatigen Untersuchungszeitraum hinaus führten.
Aufschlussreich sind weiterhin die fünf ermittelten Nutzungstypen, nach denen Lernende die App eher als Lernwerkzeug, Lernspiel, Lehrwerk, als Werkzeug zur Englischverbesserung oder zur Erprobung einer neuen Lernmethode nutzten, wobei v. a. der erste Nutzungstyp als besonders geeignet für das Selbstlernen mit der App erachtet wurde.
Weitere Lernenden- und Lehrendenwahrnehmungs- und -nutzungsstudien liegen für zum Sprachenlernen adaptierte bzw. eigens entwickelte Apps bzw. Desktopanwendungen vor, welche die Technologie der extended reality (XR, beinhaltet VR und AR) (Hoffmann 2023a, b) oder die GPS-Technologie nutzen. Letztere ermöglicht mittels der von den Forschenden entwickelten App „Platzwit neu“ ortsspezifisches, informelles Sprachenlernen in Alltagssituationen der Studierenden, indem sie diese Ereignisse in ihrer Umgebung in der App beschreiben und kommentieren können (Waragai et al. 2022). Beide Technologien nutzen virtuelle und physische (außerunterrichtliche) Lernräume, um Lerngegenstände relevanter, zugänglicher, individualisierbarer und erfahrbarer zu machen und verwenden die Lernenden- und Lehrendendaten, um eine optimale Passung auf individuelle oder kursbezogene Lernziele zu erreichen (vgl. auch Fohr 2024). […]
Sie sind neugierig und möchten mehr über digitale Hilfsmittel im DaF/DaZ-Unterricht erfahren? Der Titel kann hier bestellt werden.
| Über die Herausgeberinnen |
| Dr. Diana Feick ist Juniorprofessorin (Tenure Track) für DaF/Z mit Schwerpunkt auf empirischer Unterrichtsforschung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zuvor war sie Senior Lecturer an der University of Auckland in den Bereichen German und Applied Linguistics/Language Teaching. Zusammen mit Dr. Katrin Biebighäuser hat sie zum 2. Mal das „Mediendidaktische Symposium DaFZ“ ausgerichtet. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf vielfältigen Aspekten des Lehrens und Lernens mit digitalen Ressourcen in DaFZ. Dr. Katrin Biebighäuser leitet aktuell zwei bilinguale Grundschulen in Heidelberg, an welchen sie die theoretischen und empirischen Erkenntnisse, welche sie aus ihrer Promotion sowie Juniorprofessur im Bereich Deutsch als Fremdsprache mit dem Fokus auf Digitale Medien gewonnen hat, in der Praxis einsetzt und täglich neue spannende Einblicke in Lernkontexte unter Sprachlernbedingungen gewinnt. |
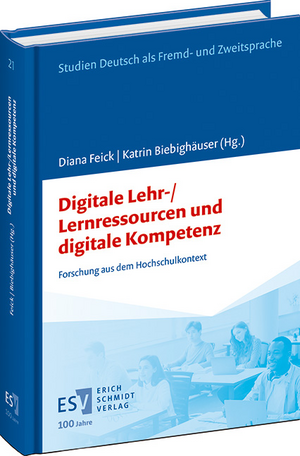 |
Digitale Lehr-/Lernressourcen und digitale Kompetenz Von Diana Feick und Katrin Biebighäuser Die forschungsbasierte Entwicklung digitaler Lehr-/Lernressourcen in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache ist im Zeitalter der Digitalisierung zunehmend gelebte Hochschulpraxis. Damit einher geht die Erforschung der Nutzung dieser Ressourcen sowie der dazu benötigten digitalen (Teil-)Kompetenzen. |
Programmbereich: Deutsch als Fremdsprache
