
Ein Werk, das heute noch Bedeutung besitzt, und damit nach verbreiteter Definition ein Klassiker ist
Michael Dallapiazza hat die bewährte Einführung in das Werk „Wolfram von Eschenbach: Parzival“ neu bearbeitet und aktualisiert. Lesen Sie hier einen Ausschnitt aus dem Werk:
Das Werk, das unter dem Namen Wolframs von Eschenbach überliefert ist, hat nach Ausweis der erhaltenen Handschriften und Handschriftenfragmente eine Verbreitung gefunden, die im deutschen Sprachraum bis zum Beginn der Buchdruckzeit einzigartig ist. Bei den Romanen Parzival und Willehalm ist diese Zahl in etwa gleich groß, aber auch beim Fragment gebliebenen Titurel scheint alles dafür zu sprechen, dass der von den folgenden Generationen viel gerühmte Wolfram auch aufgrund seiner Autorschaft an diesem für uns so rätselhaften wie faszinierenden Stück Literatur zu den großen Meistern gezählt wurde.
Sicherlich kann die Zahl der noch heute erhaltenen Textzeugen nur als Indiz für die tatsächliche Verbreitung eines Werks gelten, aber zweifellos ist eine hohe Zahl auch ein Beleg für ein hohes Maß an Beliebtheit, dafür, dass diese Werke beim Publikum über mehr als zwei Jahrhunderte hinweg eine beachtliche Resonanz gefunden hatten, weil sie etwa Identifikationsangebote bereithielten, die gerne akzeptiert wurden. Aber was genau boten sie dem zeitgenössischen Publikum? Was interessierte oder faszinierte gar an diesen Texten, dass sie wieder und wieder abgeschrieben wurden? So legitim diese Frage auch ist, wird sie in letzter Konsequenz unbeantwortet bleiben müssen, auch wenn mehr als 150 Jahre intensiver germanistischer Forschung zu Wolframs Werk und besonders zum Parzival sie oft gestellt hat. Beantwortbar aber, auch wenn die sich dann nur von Generation zu Generation daraus neu ergebende hermeneutische Vielfalt abschrecken mag, ist eher die Frage, was dieses Werk überhaupt noch für uns ist oder sein kann.
Narrative fiktionale Texte wie Wolframs Parzival sind immer mit dem Imaginären und damit aber auch mit der historischen und gesellschaftlichen Realität ihrer Epoche verknüpft. Sie erlauben jedoch fast nie einen direkten Blick auf das, was man gerne als historische Objektivität nehmen möchte, denn als Fiktion sind sie von pragmatischen Zwängen entlastet und können somit fast schrankenlos aus „Elementen der bekannten Welt eine Alternative zu dem, was als ‚wirklich‘ gilt, entwerfen. Als fiktionale Entwürfe von Realität konnten sie auch von den Zeitgenossen nur mit Hilfe von Deutungsmustern rezipiert, also „verstanden„ werden, waren also darauf angewiesen, dass ein deutendes Subjekt die verwendeten Zeichen und Symbolisationen für sich fruchtbar machen konnte. Der Literaturwissenschaftler kann diese Entwürfe beschreiben und interpretieren, kaum aber in ihnen jene phantomatische „objektive“ historische Realität rekonstruieren.
| Nachgefragt bei Prof. Dr. Michael Dallapiazza | 26.08.2025 |
| „Wolfram entfacht ein virtuoses Spiel zwischen Erzähler, Erzähltem und Publikum“ | |
 |
Die richtige Frage im richtigen Moment kann oft entscheidend sein. Nicht nur in unseren modernen Zeiten, sondern schon im Mittelalter galt Empathie offenkundig als eine Kunst, die nicht viele beherrschen. „Was fehlt dir?“ - diese Mitleidsfrage hätte Parzival, gleichnamiger Held im Roman Wolframs von Eschenbach, dem kranken Gralskönig Anfortas stellen sollen, um ihn von seinem Leid zu erlösen. Doch Parzival stellt diese Frage zunächst nicht, wird deshalb mit einem Fluch belegt und auf eine lange Reise geschickt, um seine Fehler zu sühnen. mehr … |
Manch fiktionaler Text zeichnet sich nun auch dadurch aus, dass er weit über seine eigene Zeit hinaus gewirkt hat, etwa indem er auch noch nach Jahrhunderten publiziert wurde, oder indem er die Entstehung von neuen Kunstwerken angeregt hat. Beides gilt für den Parzival. Als einer der wenigen Texte der hochhöfischen Epoche findet er in der Inkunabelzeit einen Drucker-Bearbeiter, immerhin mehr als 250 Jahre nach seinem Entstehen und in einem historisch und kulturell radikal gewandelten Umfeld, und nach weiteren 250 Jahren beginnt sich die Vormoderne literarisch für ihn zu interessieren, und dieses produktive Interesse hat bis heute noch kein Ende gefunden. Ein Werk also, das heute noch Bedeutung besitzt, und damit nach verbreiteter Definition ein Klassiker ist, ein unbestrittener Text des Kanons. Von Wagners Parsifal bis zu Adolf Muschgs Roman Der Rote Ritter lebt Wolframs Parzival weiter. Wolframs Parzival wohlgemerkt, während dem Willehalm so gut wie keine moderne literarische Neugier entgegengebracht worden ist.
[…] Die beiden Hauptteile dieser Klassiker-Lektüre sind dem Text selbst sowie seiner wissenschaftlichen Behandlung gewidmet. Das zweite Kapitel bietet nach einer knappen Übersicht über den historisch-literarischen Kontext und einleitende Informationen zu Stoff, Quellen, Auftraggeber und Werkstruktur eine notwendigerweise subjektive, kommentierende Lektüre des Romans. Ständig wird dabei der Bezug zu Wolframs Hauptquelle Chrétien hergestellt. Bereits hier werden einschlägige Forschungspositionen einbezogen, bisweilen auch ausdrücklich benannt.
Das dritte Kapitel, Unterschiedliche Lektüren, versucht sowohl die seit Beginn der wissenschaftlichen Beschäftigung zentralen Fragen der Parzival-Forschung zusammenzufassen als auch im Besonderen die aktuellen Forschungstendenzen der letzten drei Jahrzehnte zumindest ansatzweise darzustellen.
Wenn Sie neugierig geworden sind: Sie können das Buch hier bequem bestellen oder aber auch über eine örtliche Buchhandlung beziehen.
| Zum Autor |
| Prof. Dr. Michael Dallapiazza hat Germanistik, Philosophie und Romanistik in Frankfurt am Main studiert, ist geschäftsführender Herausgeber der Zeitschrift „Jahrbuch für Internationale Germanistik“ und war bis 2024 Professor für Deutsche Literatur an der Universität Bologna. Unter seinen zahlreichen Publikationen finden sich grundlegende Arbeiten zu Wolfram von Eschenbach und zur mittelalterlichen Literatur allgemein. |
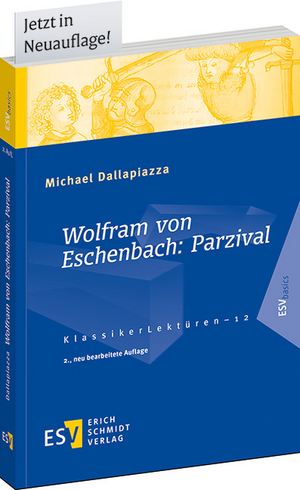 |
Wolfram von Eschenbach: Parzival Von Michael Dallapiazza Wolframs von Eschenbach „Parzival“ ist nicht nur aufgrund seiner regen Rezeptions- und Wirkungsgeschichte eines der wichtigsten Werke der mittelhochdeutschen Literatur. Beruhend auf dem altfranzösischen „Perceval“ Chrétiens de Troyes ist dieser knapp 800-jährige Roman weit mehr als nur eine Übertragung der Geschichte um den Gralsritter. Aufgrund seiner innovativen erzählerischen Strategien kann Wolframs Roman als Beginn modernen Erzählens in deutscher Sprache gesehen werden. Der „Parzival“ ist ein komplexes und durchdachtes Kunstwerk eines sich seines Könnens bewussten Autors. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik
