
„Wolfram entfacht ein virtuoses Spiel zwischen Erzähler, Erzähltem und Publikum“
Frisch gedruckt ist soeben die neu bearbeitete Einführung zu einem Klassiker der mittelhochdeutschen Literatur erschienen: zum „Parzival“ Wolframs von Eschenbach. Bitte beschreiben Sie, lieber Herr Dallapiazza, für uns, was das Besondere am „Parzival“ ist und was den Roman so sehr auszeichnet, dass er auch heute noch zahlreiche Leserinnen und Leser begeistert.
Michael Dallapiazza: Wolframs „Parzival“ fasziniert durch seine formalen, sprachlichen und narrativen Eigenheiten, die es vielleicht noch nicht zu einem modernen Werk machen, die aber, etwa nach Bachtin, im Text moderne Strategien erkennen lassen. Wolfram entfacht ein virtuoses Spiel zwischen Erzähler, Erzähltem und Publikum, die Fiktionalität seiner Erzählung, insbesondere die Erzählerfiktion scheinen Charakteristiken moderner Literatur vorwegzunehmen. Es ist dazu ein offenes Werk. Ein Künstler erkennt die Totalität eines negativen gesellschaftlichen Zusammenhangs, so hat es Karl Bertau einmal formuliert, „eine Ritterwelt aus Leiden und Tod“, und macht das in seinem Werk greifbar. Man denke an die orientalische Welt und die Figur der Belacȃne, die Vorwegnahme dort fast des modernen Toleranzgedankens.
Können Sie, lieber Herr Dallapiazza, kurz umreißen, was neu ist und was Sie für die Neuauflage ergänzt haben?
Michael Dallapiazza: Es ging in erster Linie darum, die Bibliographie zu aktualisieren und in einigen Kapiteln auf neuere Forschungstendenzen zu verweisen. Zu aktualisieren waren auch die Abschnitte zu den Editionsstrategien und zum momentanen Stand des Schweizer Parzival-Projekts.
Wie ist die Einführung im Einzelnen aufgebaut?
Michael Dallapiazza: Es war das Werk, der Autor und seine Zeit zu umreißen, der historische Hintergrund, die Entwicklung des höfischen Romans, zuerst in Frankreich, die Editionsgeschichte des „Parzival“ und dann natürlich die Stoffgeschichte, und schließlich der Bezug zu Chrétien, auf der Basis einer vergleichenden Inhaltsdarstellung.
| Auszug aus „Wolfram von Eschenbach: Parzival“ | 26.08.2025 |
| Ein Werk, das heute noch Bedeutung besitzt, und damit nach verbreiteter Definition ein Klassiker ist | |
 |
Der „Parzival“ Wolframs von Eschenbach kann mit Fug und Recht auch heute noch als Klassiker bezeichnet werden. Er ist das meist verbreitete Werk des deutschen Mittelalters und gilt als der Beginn modernen Erzählens in deutscher Sprache. Legionen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben sich über das Werk gebeugt und sind zu immer neuen Interpretationen gelangt. Der Roman erzählt davon, wie neue ritterliche Ideale wie Mut, Tapferkeit und Lebensfreude mit christlichen Werten wie Demut und Nächstenliebe in Einklang gebracht werden können. Parzival zieht auf der Suche nach Abenteuern jung in die Welt hinaus, nimmt fremde Lebensregeln ohne eigenes Nachdenken an und gerät in schuldhafte Verstrickungen. Erst nachdem er begonnen hat, sich selbst und die Zusammenhänge des Lebens besser zu verstehen, übernimmt er mehr Verantwortung für sich und für andere. Er wird schließlich zum Gralskönig berufen und Hüter des Steins, der als Quelle des ewigen Lebens erscheint. mehr … |
„Parzival“ bietet bis heute immer wieder neuen Stoff für Interpretationen. Im 3. Kapitel Ihrer Einführung legen Sie die unterschiedlichen Positionen der Forschung dar. Welche Hauptlinien sind zu verzeichnen?
Michael Dallapiazza: Noch immer sind zentrale Diskussionsstoffe der Gral und die Frage nach der Schuld, die Unterschiede zu Chrétien, dessen Rätselstruktur von Wolfram ja aufgegeben wird. Der Gegensatz von Artuswelt und Gralswelt in Form eines Doppelromans mit doppeltem Helden, Gawan, bietet weiterhin Anlass zu Debatten. Mancher Aspekt wird unter neuen Ansätzen der Forschung beleuchtet, was gerade bei Verhaltensmustern und dargestellten Mentalitäten, etwa Geschlechterrollen, naheliegt. In neuerer Zeit wird die Diskussion immer stärker vom Gender-Begriff und damit verbunden dem Konzept von Intersektionalität beeinflusst. Der Orient bei Wolfram ist ebenso ein ungebrochen aktuelles Thema der Forschung wie auch Poetologie und narrative Strategien. Körperbewusstsein, in Bezug auf die Textgestalt, etwa als Verwundbarkeit begriffen, ist ein wichtiges Thema geblieben, während die Diskussion ethisch-religiöser Aspekte, die eher typisch für frühere Phasen der Textanalysen war, in letzter Zeit zu neuer Aktualität gefunden hat. Und natürlich sind Fragen der modernen Rezeption weiterhin ein aufmerksam verfolgter Gegenstand.
Zum Abschluss: Mich persönlich hat im „Parzival“ immer die nicht gestellte Mitleidsfrage beschäftigt — „Oheim, was fehlt dir?“ —, die ich für ungemein modern halte. Welche Stelle im „Parzival“ ist Ihre Lieblingsstelle?
Michael Dallapiazza: Diese Stelle ist in der Tat ungemein modern und faszinierend. Eine Lieblingsstelle zu wählen, fällt mir natürlich schwer. Mein Lieblingsvers ist dieser Satz: „disiu ȃventiure/ vert ȃne der buoche stiure“ (115, 29—30): „diese Erzählung benötigt keine Buchgelehrsamkeit“ (wörtlich: fährt ihren Weg ungesteuert von Buchgelehrsamkeit). Meine Lieblingsstelle, wenn ich mich denn entscheiden muss, findet sich kurz davor, 110, 11—111, 12, als die hochschwangere Herzeloyde 14 Tage vor der Geburt „Kind und Bauch“ umfängt, und dann zärtlich zum ungeborenen Kind und zu ihren Brüsten spricht: „Du bist das Gefäß der Speise des Kindes, die es vor sich her gesandt hat …“.
Diese Szene in ihrer Einzigartigkeit in der gesamten mittelalterlichen Literatur ist bestechend, eigentlich undenkbar im Kontext höfischer Dichtung. Herzeloyde beginnt mit der Frucht ihres Leibes Zwiesprache zu halten, ohne sich darum zu kümmern, was umstehende Zeugen davon denken könnten. Dazu die Worte des Erzählers: „si tet wîpliche fuore kunt“ (110, 28), sie handele sehr fraulich! Sie drückt ein paar Tropfen Milch heraus und sieht sie als eine Art Taufe, was auch einen Bezug zur Tränentaufe der Belacȃne herstellt. Beides, Tränentaufe und Milchtaufe, kennt die Theologie der Zeit!
Lieber Herr Dallapiazza, haben Sie herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Interview!
----------------------------------------
Wenn es Sie, liebe Leserinnen und Leser, nun interessiert, den Band zu lesen und zu erwerben, dann finden Sie alle relevanten Informationen hier.
| Zum Autor |
| Prof. Dr. Michael Dallapiazza hat Germanistik, Philosophie und Romanistik in Frankfurt am Main studiert, ist geschäftsführender Herausgeber der Zeitschrift „Jahrbuch für Internationale Germanistik“ und war bis 2024 Professor für Deutsche Literatur an der Universität Bologna. Unter seinen zahlreichen Publikationen finden sich grundlegende Arbeiten zu Wolfram von Eschenbach und zur mittelalterlichen Literatur allgemein. |
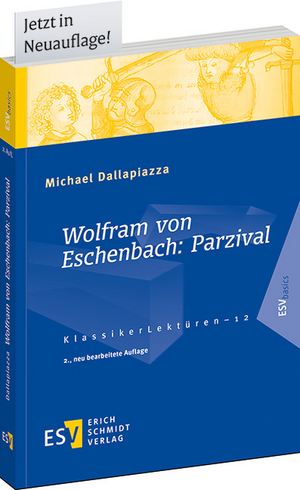 |
Wolfram von Eschenbach: Parzival Von Michael Dallapiazza Wolframs von Eschenbach „Parzival“ ist nicht nur aufgrund seiner regen Rezeptions- und Wirkungsgeschichte eines der wichtigsten Werke der mittelhochdeutschen Literatur. Beruhend auf dem altfranzösischen „Perceval“ Chrétiens de Troyes ist dieser knapp 800-jährige Roman weit mehr als nur eine Übertragung der Geschichte um den Gralsritter. Aufgrund seiner innovativen erzählerischen Strategien kann Wolframs Roman als Beginn modernen Erzählens in deutscher Sprache gesehen werden. Der „Parzival“ ist ein komplexes und durchdachtes Kunstwerk eines sich seines Könnens bewussten Autors. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik
