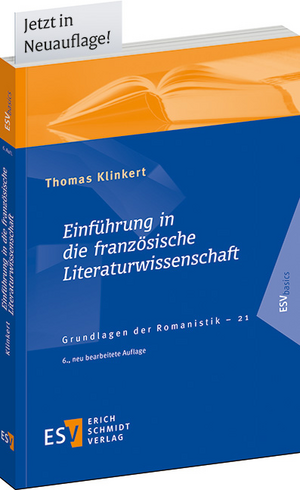„Eine Liebe zum Lernen und Erkunden von Sprachen sollte man mitbringen.“
Lieber Herr Klinkert, pünktlich zum Semesterstart erscheint Ihre Einführung in die französische Literaturwissenschaft, die nun schon mehrere Jahrgänge an Studierenden gut durchs Studium begleitet hat, in der 6. Auflage. Das ist – in der Zeit der kurzlebigen Bücher – ein toller Erfolg. Als Sie das Buch im Jahr 2000 erstmals veröffentlichten: Haben Sie da gedacht, dass es so lange auf dem Markt bleiben würde? Was ist das Erfolgsrezept?
Thomas Klinkert: Wenn man ein Buch schreibt, hat man natürlich immer die heimliche Hoffnung, dass es möglichst viel gelesen werde. Angesichts der geringen Auflagenzahlen, welche wissenschaftliche Veröffentlichungen normalerweise haben und die in der Romanistik im Bereich von ca. 120 verkauften Büchern liegen, kann man – noch dazu als junger, unbekannter Wissenschaftler – keinesfalls damit rechnen, mit einem Buch ein großes Publikum zu erreichen. Umso überraschter und erfreuter war ich damals, als ich feststellte, dass die Einführung großen Zuspruch erfuhr und es in rascher Folge zu mehreren Neuauflagen kam.
Im Herbst 2007 haben wir bereits die vierte Auflage herausgebracht, damals erstmals mit dem neuen Layout. Dass nun seither in zeitlich deutlich größeren Abständen in den Jahren 2017 und 2025 zwei weitere Neuauflagen erscheinen konnten, war nicht unbedingt erwartbar angesichts der geänderten Situation auf dem Buchmarkt mit zahlreichen Einführungen, die gezielt auf die Bedürfnisse der Bachelor- und Master-Studierenden ausgerichtet waren. Die Konzeption meiner unter noch völlig anderen Studienbedingungen entstandenen Einführung bestand ja darin, dass ein relativ hoher theoretischer Anspruch auf allgemein verständliche Art und Weise vermittelt werden sollte. Dies erforderte eine Konzentration auf bestimmte Fragestellungen und einen Verzicht auf zahlreiche Themenfelder, die man in einer Einführung ebenfalls hätte behandeln können. Die mit dieser Konzentration verbundene Intensität und hoffentlich auch Anschaulichkeit ist möglicherweise der Grund dafür, dass meine Einführung in die französische Literaturwissenschaft auch nach 25 Jahren noch bei einem Teil des studentischen Publikums Anklang findet und somit diese Neuauflage rechtfertigt.
In dieser neuen Auflage haben Sie ein Kapitel zur Gegenwartsliteratur ergänzt: Können Sie kurz umreißen, welche Autoren/Autorinnen Sie vorstellen und warum?
Thomas Klinkert: In dem Kapitel, welches sich mit historisch unterschiedlichen Aufschreibesystemen beschäftigt und bislang aus drei Unterkapiteln zum Mittelalter, zur Renaissance und zum 19. Jahrhundert bestand, habe ich ein viertes Unterkapitel zur Gegenwart ergänzt, also zur Literatur im Aufschreibesystem des späten 20. und des frühen 21. Jahrhunderts. War das Mittelalter geprägt von der Herstellung und Zirkulation von Manuskripten, die Renaissance von der durch den Buchdruck verursachten Revolution, das 19. Jahrhundert durch die aufkommende Massenpresse, so ist das charakteristische Merkmal der Gegenwart ein vielgestaltiges, durch die Konkurrenz von geschriebenen Texten und audiovisuellen Medien und die Dominanz des Internets geprägtes System.
Wie sich die traditionell dem gedruckten Buch verbundene Literatur in diesem neuartigen Mediensystem situieren kann, habe ich an zwei prominenten Beispielen der aktuellen französischen Literatur zu zeigen versucht. Dies ist zum einen der Autor François Bon, der einerseits ganz traditionell Bücher bei Verlagen publiziert und andererseits als einer der ersten Autoren seit den späten Neunzigerjahren eine Internetseite betreibt, auf der er seine eigenen Texte, ihre Vorstufen, Kommentare, Blogs, Vorträge und auch audiovisuelle Produktionen wie einen im Anschluss an seinen Roman Paysage Fer (2000) entstandenen Film zur Verfügung stellt. Zum anderen habe ich am Beispiel des Romans Cher Connard (2022) von Virginie Despentes durch eine Analyse der Inhalts- und Darstellungsebene nachgezeichnet, wie Intimkommunikation im Zeitalter des Internets funktioniert. Dadurch werfe ich auch zwei Schlaglichter auf die gegenwärtige französische Literatur im Allgemeinen.
| Auszug aus: „Einführung in die französische Literaturwissenschaft“ | 23.09.2025 |
| Wechselwirkungen zwischen Literatur im herkömmlichen Sinn und dem Internet als Universalmedium | |
 |
Was ist eigentlich genau Literaturwissenschaft und wie entsteht Literatur, wie verbreitet sie sich und wie wird sie rezipiert? Wie gelingt eine Textanalyse und was ist nochmal die Zeichentheorie? Diese Fragen stellen sich nicht nur angehende Studierende der Literaturwissenschaft, auch höhere Semester müssen sich manchmal auf solche grundlegenden „basics“ zurückbesinnen. mehr … |
Wie beurteilen Sie die Verlagerung von Literatur ins Internet, also Blog-Tagebücher oder Fortsetzungsromane auf Social-Media? Und folgen Sie selber Autoren und Autorinnen im Netz?
Thomas Klinkert: Als ein im letzten Jahrtausend geborener Literaturwissenschaftler habe ich persönlich eine große Vorliebe für gedruckte Bücher, und ich versuche diese Vorliebe auch bei meinen mittlerweile nach der Jahrtausendwende geborenen Studierenden beliebt zu machen. Zugleich ist mir bewusst, dass sich die Kommunikation aufgrund der Omnipräsenz von Computer, Tablet und Smartphone heute zunehmend in den virtuellen Bereich verlagert, weshalb ich es sinnvoll finde, dass auch Autorinnen und Autoren dem Rechnung tragen, indem sie wie etwa der bereits erwähnte François Bon mit ihrem Publikum nicht nur durch Bücher, sondern auch mittels einer Webseite kommunizieren. Ich denke, dass damit die Möglichkeit einer Wahrnehmung von Literatur durch die jüngeren, nicht mehr unbedingt buchaffinen Generationen erhalten bleibt.
Allerdings ist bei der Rezeption von Literatur im Internet die Intensität einer Lektüre, welche für anspruchsvolle literarische Texte nun mal erforderlich ist, nicht in vollem Maße gewährleistet. Wahrnehmungspsychologisch ist es gut und nachhaltig, einen literarischen Text als gedruckten zu rezipieren und nicht auf einem flimmernden Bildschirm in häufig sehr kleiner, schwer zu lesender Schriftgröße und als bloße Oberflächenerscheinung. Ich sehe daher die zunehmende Verlagerung der Kommunikation in den elektronischen Bereich mit gemischten Gefühlen, bin aber auch der Meinung, dass man die beiden Formen intelligent kombinieren kann, und genau das versuche ich meinen Studierenden zu vermitteln.
Das wichtigste Instrument für Studierende der Literaturwissenschaft ist wohl die Freude am Lesen. Was sollte man noch unbedingt mitbringen, wenn man ein solches Studium anstrebt?
Thomas Klinkert: Neben der in der Tat unbedingt erforderlichen Freude am Lesen und Entdecken der Literatur in all ihrer Buntheit, Vielfalt, Reichhaltigkeit, historischen Tiefe und Komplexität sollte man – und das gilt speziell für die Fremdsprachenphilologien wie die Romanistik – eine Liebe zum Lernen und Erkunden von Sprachen mitbringen. Dieses Lernen ist ein unendlicher Prozess und setzt sich mit jeder Lektüre von Büchern fort. Als weitere wichtige Voraussetzung sehe ich die Bereitschaft, sich auf wissenschaftliches Denken einzulassen, wobei die besondere Kunst darin besteht, die zweifellos manchmal anstrengende wissenschaftliche Analysearbeit mit dem zu verbinden, was Roland Barthes „le plaisir du texte“ nannte, also der Freude und dem Genuss, der sich aus dem Umgang mit ästhetischen Artefakten ergibt.
Mit der rentrée littéraire 2025 liefert uns der französische Buchmarkt wieder viel neuen Lesestoff. Haben Sie eine Empfehlung für unsere Leserinnen und Leser, eine Entdeckung des aktuellen Bücherherbsts, und einen Klassiker, der gut zum Herbst passt?
Thomas Klinkert: Seit vielen Jahren gebe ich im Herbstsemester ein Seminar zur aktuellen Liste Goncourt. Ich lese mit meinen Studierenden immer eine Auswahl aus dieser Liste, dieses Jahr sind es sechs Romane. Besonders interessant finde ich in der von den Teilnehmern des Seminars getroffenen Auswahl den Roman Kolkhoze von Emmanuel Carrère, der sich mit der Geschichte seiner jüngst verstorbenen Mutter, der Osteuropahistorikerin Hélène Carrère d’Encausse, beschäftigt und diese in eine bis in das frühe zwanzigste Jahrhundert zurückreichende Familien- und Zeitgeschichte einbettet.
Einer meiner Lieblingsklassiker der französischen Literatur ist Le Rouge et le Noir von Stendhal, ein 1830 erschienener Roman über die damalige französische Gesellschaft in all ihren Gegensätzen und Widersprüchen, die Geschichte eines begabten jungen Mannes, der sich aufgrund seiner niederen Herkunft ausgegrenzt fühlt und ehrgeizig danach trachtet, in die höchsten Kreise aufzusteigen, sein Glück aber erst dann findet, als er aufgrund des versuchten Mordes an seiner ehemaligen Geliebten im Gefängnis landet und zum Tode verurteilt wird. In seiner schmerzvollen Schönheit und Zerrissenheit ist dies einer der besten Romane, die ich kenne, und aufgrund seiner Länge kann man ihn, meine ich, an dunkler und länger werdenden Herbstabenden besonders gut lesen.
Lieber Herr Klinkert, vielen Dank für diesen interessanten Einblick!
-----------------------------------------
Ist Ihr Interesse an dem Einführungswerk geweckt? Dann finden Sie alle relevanten Informationen hier.
| Zum Autor |
| Thomas Klinkert ist ordentlicher Professor für Französische Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Seine Forschungsschwerpunkte sind u.a.: Literatur und Wissen, Literaturtheorie (insbes. Systemtheorie, Theorie der Fiktion) und Methodik der Textanalyse sowie Erzählliteratur des 20. und 21. Jahrhunderts. Er hat Studien zu Dante, Marcel Proust, Samuel Beckett, Claude Simon, Jorge Semprún, Primo Levi, Paul Celan u.a. verfasst. |
Programmbereich: Romanistik