
Einkommensteuerrechtliche Behandlung von Leistungen im Zusammenhang mit einem Versorgungsausgleich
Das BMF regelt in einem neuen, das Schreiben vom 9. April 2010 ersetzenden, Schreiben die einkommensteuerrechtliche Behandlung von Leistungen im Zusammenhang mit einem Versorgungsausgleich nach § 10 Abs. 1a Nr. 3 und 4 sowie § 22 Nr. 1a EStG.
Zivilrechtliche Ausgangslage
In einem ersten allgemeinen Teil seines neuen Schreibens trifft das BMF Aussagen zur zivilrechtlichen Regelung des Versorgungsausgleichs. Der Versorgungsausgleich wird bei einer ehelichen Scheidung durchgeführt, um die in der Ehe erworbenen Rentenanrechte zwischen beiden Ehegatten gerecht zu verteilen. Seit der Reform zum 1. September 2009 werden dabei sämtliche während der Ehe erworbenen Anrechte auf eine Versorgung im Alter oder bei Invalidität hälftig geteilt. Der Versorgungsausgleich wirkt sich regelmäßig zugunsten desjenigen Ehegatten aus, der sich keine oder nur eine geringere eigenständige Altersversorgung – beispielsweise wegen der Führung des Haushalts und der Betreuung und Erziehung der Kinder – aufbauen konnte.
Dies betrifft insbesondere Anrechte aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus anderen Regelsicherungssystemen wie der Beamtenversorgung oder der berufsständischen Versorgung, aus der betrieblichen Altersversorgung und auf eine Rente gerichtete Anrechte aus der privaten Alters- und Invaliditätsvorsorge (z. B. „Riester“- oder„Rürup“-Rente). Produkte, die ausschließlich Kapitalleistungen vorsehen (z. B. Kapitallebensversicherung), sind hingegen nicht Gegenstand des Versorgungsausgleichs. Die Regelungen gelten auch bei der Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.
Ausgleichsleistungen zur Vermeidung eines Versorgungsausgleichs
Zivilrechtlich können Ehegatten den Versorgungsausgleich ganz oder teilweise ausschließen. Der Ausschluss kann sowohl den gesetzlichen Versorgungsausgleich (interne und externe Teilung) als auch schuldrechtliche Ausgleichsansprüche (d. h. noch nicht ausgeglichene Anrechte) umfassen. Die ausgleichsberechtigte Person kann eine zweckgebundene Abfindung für ein noch nicht ausgeglichenes Anrecht (d. h. einen schuldrechtlichen Anspruch) von der ausgleichspflichtigen Person verlangen. Die Abfindung ist an den Versorgungsträger zu zahlen, bei dem ein bestehendes Anrecht ausgebaut oder ein neues Anrecht begründet werden soll (§ 23 VersAusglG).
| Hier bleiben Sie auf dem aktuellen Stand im Bereich Steuern. |
| Abonnieren Sie doch einfach hier unseren kostenlosen Newsletter Steuern |
Steuerrechtliche Behandlung
Die ausgleichspflichtige Person kann Ausgleichsleistungen zur Vermeidung des Versorgungsausgleichs als Sonderausgaben abziehen (§ 10 Abs. 1a Nr. 3 EStG). Dies gilt unabhängig davon, ob die Ausgleichsleistung eine beamtenrechtliche, eine öffentlich-rechtliche, eine private oder eine betriebliche Altersvorsorge betrifft und unabhängig davon, ob eine steuerliche Förderung gewährt wurde. Die ausgleichsberechtigte Person muss die Ausgleichsleistung als sonstige Einkünfte nach § 22 Nummer 1a EStG versteuern (sogenanntes Korrespondenzprinzip).
Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug sind:
- Unbeschränkte Einkommensteuerpflicht der ausgleichsverpflichteten und -berechtigten Person
- Angabe der die Identifikationsnummer (IdNr.) der ausgleichsberechtigten Person in der Steuererklärung der ausgleichsverpflichteten Person
Die ausgleichspflichtige Person kann Ausgleichsleistungen zur Vermeidung des Versorgungsausgleichs auf Antrag und mit Zustimmung der ausgleichsberechtigten Person als Sonderausgaben abziehen. Die Abzugsmöglichkeit für Ausgleichsleistungen zur Vermeidung des Versorgungsausgleichs umfasst sowohl Leistungen der ausgleichspflichtigen Person an die ausgleichsberechtigte Person als auch Zahlungen der ausgleichspflichtigen Person an den Versorgungsträger der ausgleichsberechtigten Person. Nicht umfasst werden Zahlungen der ausgleichspflichtigen Person an den eigenen Versorgungsträger zur Wiederauffüllung der eigenen Ansprüche.
Weiterhin werden Aussagen zu Ausgleichszahlung zur Vermeidung einer späteren Versorgungskürzung (sog. „Wiederauffüllungsleistungen“) getroffen.
Beim gesetzlichen Versorgungsausgleich unterfallen dem Wertausgleich bei der Scheidung alle Anrechte, es sei denn, die Ehegatten haben eine davon abweichende wirksame Vereinbarung über den Versorgungsausgleich nach den §§ 6-8 VersAusglG getroffen oder die Anrechte sind gemäß § 19 VersAusglG noch nicht ausgleichsreif. Vorrangig ist stets die interne Teilung nach den §§ 10-13 VersAusglG vorzunehmen. Die externe Teilung nach den §§ 14-17 VersAusglG ist nachrangig und nur in den gesetzlich bestimmten Fällen möglich.
Der BMF schildert die steuerrechtliche Behandlung bei der Übertragung von Anrechten im Wege der internen sowie der externen Teilung und erläutert diese anhand von Beispielen.
Schuldrechtliche Ausgleichszahlungen
Ehegatten können vereinbaren, sich ganz oder teilweise Ausgleichsansprüche nach der Scheidung vorzubehalten (Ehevertrag oder gerichtliche Vereinbarung). So erfolgt der Versorgungsausgleich insoweit durch (spätere) schuldrechtliche Ausgleichszahlungen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 i. V. m. § 20 VersAusglG).
Die steuerrechtliche Behandlung solcher schuldrechtliche Ausgleichszahlungen von der ausgleichspflichtigen an die ausgleichsberechtigte Person besagt, dass solche Zahlungen im Ergebnis zu einem Transfer steuerbarer und steuerpflichtiger Einnahmen führen. Während § 10 Abs. 1a Nr. 4 EStG regelt, unter welchen Voraussetzungen und inwieweit bei der ausgleichspflichtigen Person ein Sonderausgabenabzug in Betracht kommt, bestimmt § 22 Nr. 1a EStG dementsprechend die Besteuerung dieser Leistungen bei der ausgleichsberechtigten Person (Korrespondenzprinzip).
Desweiteren beschreibt das BMF mögliche Formen der Ausgleichszahlungen mit ihren steuerlichen Auswirkungen und gibt hierzu Beispiele. Möglich sind laufende Leistungen (als Basisversorgung oder in Form eines Versorgungsbezugs nach § 19 EStG, als private Rente, Versorgung aus einem Altersvorsorgevertrag, einem Pensionsfonds, einer Pensionskasse oder einer Direktversicherung) oder andere Leistungen (Abtretung von Versorgungsansprüchen nach § 21 VersAusglG/ § 1587i BGB a. F.; Anspruch auf Ausgleich von Kapitalzahlungen u.a.)
Quelle: Schreiben des BMF vom 21. März 2023
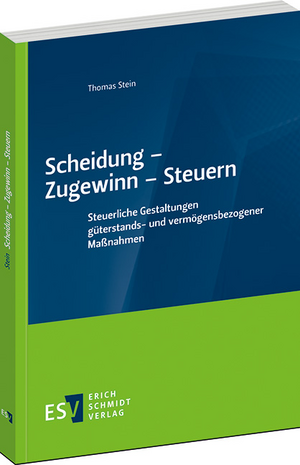 |
|
(ESV/cmx)
Programmbereich: Steuerrecht
