
„‚es‘ in eine Geschichte verwandelt, die man erzählen kann“
In Barbara Honigmanns Roman „Soharas Reise“ (1996) lernt die Titelfigur in ihrer neuen Straßburger Wohnung eine jüdische Nachbarin kennen, Frau Kahn. Sie trägt eine „tätowierte Nummer auf ihrem Unterarm“, ist vor fünfzig Jahren aus Deutschland weggezogen, will seither kein Deutsch mehr sprechen. Über ihr Schicksal, über die Deportation der Eltern, die Ermordung ihres Mannes will sie nichts erzählen; und wenn sie es doch einmal versucht, fehlen ihr die Wörter und die Begriffe:
Frau Kahn sagt immer „diese Lager“ und „die Kannibalen“, sie hat eine eigene Sprache für „das“ gefunden, weil man „es“, wie sie sagt, sowieso nicht beschreiben kann. Manche, die „das“ erlebt haben, […] haben „es“ in eine Geschichte verwandelt, die man erzählen kann […]. „Mir ist das nicht gelungen“, sagt sie.
Das Scheitern an einer Sprache für das Unsagbare
Die deutschsprachige Literatur steht vor der Aufgabe, an der Frau Kahn meistens scheitert: „es“ – die Erinnerung an die systematische Ermordung der europäischen Juden in der Zeit des Nationalsozialismus – in einen Text zu verwandeln, eine Sprache für „es“ zu finden. Und für die Nachgeborenen wie Barbara Honigmann tritt eine weitere Herausforderung hinzu: den Umgang mit dem „Unsagbaren“ in ihrer Gegenwart zu thematisieren. Die Deutschen haben – bis heute – in ihrer Sprache ebenso wenig wie Frau Kahn einen Begriff gefunden, „es“ zu benennen.
Der von den Nationalsozialisten proklamierte Euphemismus „Endlösung“ verschwand als indiskutabel bald (wenn auch nicht sofort und vollständig) aus der Diskussion. In der Wissenschaft und später auch im allgemeinen Sprachgebrauch setzten sich im Laufe der Zeit zwei Bezeichnungen durch, die beide aus dem Tanach (Alten Testament) stammen: das hebräische Wort „shoah“ (Katastrophe, Unheil) und das ins Griechische übersetzte „holocaustos“, „holocaustoma“ (Brand, ganz und gar verbrennen); es wurde über das latinisierte „holocaustum“ unter anderem ins Französische und Englische übernommen (nicht ins Deutsche, da Luther nach dem ursprünglichen religiösen Verständnis „Brandopfer“ übersetzte). Die beiden Begriffe wurden vor 1933 selten gebraucht, gelegentlich jedoch bereits im Kontext der Ermordung von Juden.
Schon in den frühen 1940er Jahren finden sich vereinzelte Belege, dass sie zur Bezeichnung des nationalsozialistischen Massenmordes an den Juden verwendet wurden. Da die meisten politisch-historischen Arbeiten zu diesem Thema aus den englischsprachigen Ländern kamen, setzte sich in den USA und Europa der Begriff „holocaust“ (in englischer Schreibweise und Aussprache) durch. In Israel wurde nur der Begriff „shoah“ gebraucht, der programmatisch bereits in der Unabhängigkeitserklärung 1948 steht. In Deutschland wurden die Bezeichnungen erst spät allgemeiner bekannt. Sie fanden vor allem durch Bildmedien weite Verbreitung: durch die amerikanische Fernsehserie „Holocaust“ (1978, deutsch 1979) sowie durch den Film „Shoah“ von Claude Lanzmann (1985).
Beide Begriffe können ein zentrales Problem nicht lösen: Für das genuin deutsche Verbrechen hat die deutsche Sprache nur Fremdwörter, in denen nichts mehr auf das Bezeichnete hinweist. Versuche, „Holocaust“ durch Schreibung oder Aussprache ‚einzudeutschen‘ blieben ebenso vergeblich wie der Vorschlag, einen Begriff („Auschwitz“, „die Katastrophe“) pars pro toto zu wählen.
| Nachgefragt bei: Klaus Weissenberger | 26.07.2017 |
| Weissenberger: Was Mann, Lasker-Schüler und Celan im NS-Exil verband | |
 |
Mit Kunstprosa können literarische Formen wie Tagebucheinträge, Briefe oder Essays bezeichnet werden. Die ESV-Redaktion sprach mit dem Literaturwissenschaftler Klaus Weissenberger über die Kunstprosa deutscher Autoren während des NS-Exils. mehr … |
Das Geschehen, wie Frau Kahn in Honigmanns Roman, einfach „es“ zu nennen, zeugt zwar von Hilflosigkeit, kann aber im Untertitel eines Buches über die Shoah in der Literatur ein Stolperstein sein, der auf dieses Problem eines jeden deutschen nichtjüdischen Literaturwissenschaftlers hinweist.
„Deutsch-jüdisch“: mit Bindestrich
Die Anfänge der „deutsch-jüdischen Literatur“ liegen in der Epoche der Aufklärung, im späten 18. Jahrhundert. In dieser Zeit begannen Juden in Mittel- und Osteuropa, in deutscher Sprache säkulare, also auch literarische Texte zu schreiben und zu veröffentlichen. Diese Literatur fand bereits im 19. Jahrhundert einen Höhepunkt von weltliterarischer Bedeutung: im Werk Heinrich Heines. Der Dichter galt zwar seinen vielen, zumeist antisemitischen Gegnern als Zerstörer der deutschen Sprache und Literatur, der wachsenden Zahl seiner Anhänger jedoch als einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller.
Der Bindestrich zwischen den Adjektiven „deutsch“ und „jüdisch“ wurde lange Zeit als Verheißung der gelungenen „Assimilation“ oder „Akkulturation“ angesehen. Ende des 19. Jahrhunderts entstand jedoch eine innerjüdische Gegenbewegung. Zionisten hielten die „deutsch-jüdische Symbiose“ für eine Fehlentwicklung und forderten, dass auch deutsche Juden wieder hebräisch schreiben sollten. Nach der Shoah wurde das Streben nach Gemeinsamkeit als Irrweg von Beginn an gebrandmarkt, als im wahrsten Sinne des Wortes tödlicher Irrtum. Dieses Diktum von Gershom Scholem „Wider den Mythos vom deutsch-jüdischen Gespräch“ (1964) wurde jahrzehntelang wiederholt. Dan Diner gab der Diskussion 1986 eine Wendung, als er ausführte, dass gerade durch die Shoah Deutsche und Juden nicht mehr voneinander loskommen könnten, verbunden seien in einer „negativen Symbiose“.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts begann ein von ideologischen und politischen Beurteilungen befreiter Umgang mit dem Begriff „deutsch-jüdisch“, der seither, nun seine schwierige Geschichte reflektierend, von einer jüngeren Forschergeneration wieder unbefangen gebraucht wird. Auch wer das Adjektiv noch immer scheut, bestreitet nicht, dass jeder jüdische Autor, der nach 1945 in Deutschland oder Österreich in deutscher Sprache schreibt, sich in irgendeiner Form mit der Shoah befasst (wobei auch das Beschweigen eine Art der Befassung darstellt). Der literarische Umgang mit der Shoah bildet mithin eine thematische Konstante, die das heterogene Schreiben von Generationen jüdischer Schriftsteller verbindet.
Wenn Sie mehr lesen wollen, empfehlen wir Ihnen das Buch „Deutsch-jüdische Literatur und die Shoah. Schreiben über ‚es‘“ von Hartmut Steinecke zur Lektüre.
| Zur Person |
| Hartmut Steinecke (1940–2020) studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie in Saarbrücken und Bonn, wo er 1966 mit einer Dissertation über Hermann Broch promovierte. Nach seiner Promotion war er von 1967 bis 1973 wissenschaftlicher Assistent am Germanistischen Seminar der Bonner Universität, wo er sich 1973 mit einer Arbeit über Romantheorie und Romankritik in Deutschland habilitierte. 1974 wurde er Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Paderborn. Dort lehrte er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2005. 1992 gründete er in Paderborn das Jenny Aloni-Archiv. Im Jahr 2002 wurde Steinecke in die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Zahlreiche ausländische Gastprofessuren und Ehrungen sowie eine Vielzahl von Publikationen, Vorträgen und Tagungen zur deutsch-jüdischen Literatur seit den 1960er Jahren spiegeln zudem seine rege Tätigkeit wider. Kurz nach der Fertigstellung seines Buchs ist Hartmut Steinecke verstorben. Der Erich Schmidt Verlag trauert um einen langjährigen verdienten Herausgeber, Autor, Forscher und ganz besonderen, liebenswürdigen Menschen. |
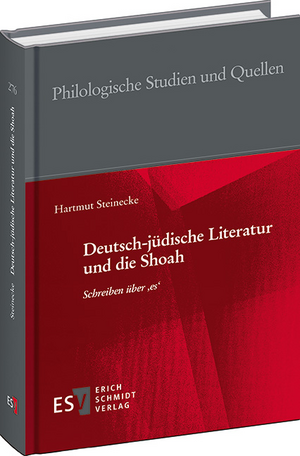 |
Deutsch-jüdische Literatur und die Shoah von Hartmut Steinecke Die Shoah war von Beginn an ein zentrales Thema der deutsch-jüdischen Literatur und sie ist es bis heute, über 75 Jahre später, geblieben. Dieses Buch zeigt eine Reihe neuer Aspekte dieses spannenden Prozesses. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik
