
Feststellung der Voraussetzungen für die Steuerfreiheit von Sanierungserträgen
Forderungsverzicht im Rahmen einer Sanierung
Der Kläger ist einziger Komplementär sowie alleiniger Treugeber einer KG, die zahlreiche Tankstellen betreibt. Größter Handelspartner der KG war die A-AG.
Bereits seit Jahren befand sich die KG in finanziellen Schwierigkeiten, bevor dann im Jahr 2010 im Rahmen eines groben Sanierungskonzepts beabsichtigt wurde, dass die F-GmbH in die KG investiert. Letztlich erwarb diese jedoch nur einen Großteil der Tankstellen von der KG, die das Geld wiederum zur Schuldentilgung verwendete.
Die Forderungen der A-AG gegen die KG beliefen sich in 2012 auf über 4 Mio. EUR, sodass diese letztlich die Zwangsvollstreckung gegen die KG betrieb. Nach fruchtloser Vollstreckung schlossen die KG und die A-AG schließlich einen Abfindungsvergleich. Demnach zahlt die KG einen Abgeltungsbetrag von 50.000 EUR und die A-AG verzichtet auf all ihre Ansprüche. Der Forderungsverzicht der A-AG führte bei der KG zu einem Buchgewinn von knapp 4 Mio. EUR.
Der Kläger begehrte die Steuerfreistellung nach § 3a EStG, die das Finanzamt jedoch mangels Sanierungseignung und fehlender Sanierungsabsicht verneinte.
Im Rahmen der Revision musste der BFH nun entscheiden, wann von einer Sanierungseignung i.S. von § 3a Abs. 2 EStG auszugehen ist und inwiefern es hierfür eines Sanierungskonzeptes bedarf. Darüber hinaus war zu klären, ob eine Sanierungsabsicht des Gläubigers immer vorliegt, wenn dieser im Zusammenhang mit einer Sanierung auf seine Forderung verzichtet.
Was ist notwendig für die Sanierungseignung?
Einleitend stellt der BFH zwar klar, dass ein schriftliches Sanierungskonzept keine notwendige Voraussetzung für die Anwendung des § 3a EStG ist. Das Vorliegen einer Sanierungsabsicht kann aber nicht bereits vermutet werden, wenn ein Gläubiger in Zusammenhang mit einer Sanierung auf seine Forderung verzichtet.
Das Gesetz beinhaltet keine festen Kriterien für die Feststellung der Sanierungseinigung. Daher kann auch ein schriftliches Sanierungskonzept nicht als notwendige Voraussetzung gesehen werden. Sofern ein solches jedoch existiert, ist dies ein wesentliches Indiz für das Vorliegen einer Sanierungseignung dar. Genauso verhält es sich mit einem rückblickend tatsächlichen Sanierungserfolg.
Sofern jedoch keines dieser sog. „Hauptindizien“ vorliegt und die Sanierungseignung auch nicht anderweitig erkennbar ist, gilt sie als nicht nachgewiesen.
Nach dem BFH kann die Sanierungsabsicht nicht bereits deshalb unterstellt werden, wenn ein Gläubiger auf eine Forderung im Zusammenhang mit der Sanierung eines Unternehmens ganz oder teilweise verzichtet. Denn sonst wäre eine Sanierungsabsicht stets gegeben, wenn ein Forderungsverzicht vorliegt, mit der Folge, dass das Tatbestandsmerkmal "Sanierungsabsicht" leerliefe. Dies wird ausdrücklich abgelehnt.
Im Ergebnis hatte das Finanzamt den Buchgewinn aus dem Forderungsverzicht damit richtigerweise als steuerpflichtig behandelt.
Bei uns bleiben Sie auf dem aktuellen Stand im Bereich Steuern. |
| Abonnieren Sie doch gleich hier unseren kostenlosen Newsletter Steuern. |
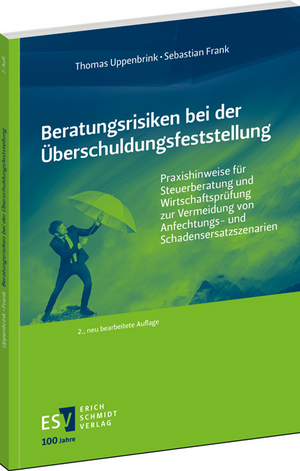 |
Beratungsrisiken bei der Überschuldungsfeststellung von Thomas Uppenbrink, Sebastian Frank
Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung (BGH IX ZR 285/14) und aktuell gültigem Gesetz (§ 102 StaRUG) haben Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer grundsätzlich regelmäßig zu prüfen, ob bei Feststellung einer buchmäßigen bzw. handelsrechtlichen Überschuldung die Fortführung des Unternehmens noch wahrscheinlich ist und die Mandantin weiterhin zahlungsfähig bleibt.
Viele Vorlagen und Musterformulierungen unterstützen Sie dabei, die Zusammenarbeit zu optimieren und strafrechtliche Konsequenzen, Anfechtungen oder Schadensersatzforderungen konsequent zu vermeiden. |
(ESV/cmx)
Programmbereich: Steuerrecht
