
Genus-Gender-Divergenzen
Lesen Sie hier einen Ausschnitt aus dem Beitrag von Katharina Turgay aus Heft 4/2022 der Zeitschrift „Deutsche Sprache“:
-----------------------------------------------------------
Sexismus in der Sprache wird bereits seit einigen Jahrzehnten moniert. Im Sinne der Politischen Korrektheit ist es Ziel der feministischen Linguistik, „die u. a. soziale Gleichberechtigung durch geschlechtergerechte Sprache [zu] institutionalisieren […], da andernfalls Frauen entweder ignoriert oder abgewertet würden“ (Fischer 2004, S. 178). Politisch korrekt zu handeln bedeutet in diesem Kontext unter anderem, sprachliche Ausdrücke zu vermeiden, die im Hinblick auf das Geschlecht diskriminieren. Dabei geht es um die sprachliche Repräsentation des Genders als soziales Geschlecht in Abgrenzung zum Sexus, dem natürlichen oder biologischen Geschlecht.
Da die Sprache eine wichtige Rolle bei der Politischen Korrektheit spielt, ist ein bewusster Umgang mit der Bezeichnung von Personen durchaus sinnvoll im Sinne der Gleichberechtigung von Personen jeden Geschlechts. Ich gehe davon aus, dass Sprecher*innen die Intention haben, in ihrem Sprachgebrauch Gender zu berücksichtigen und dementsprechend sensibel damit umgehen. Das Ziel meines Beitrags ist es, zu ermitteln, wie Äußerungen, bei denen Gender und das grammatische Genus nicht übereinstimmen, beurteilt werden und ob eine Tendenz zu grammatisch korrekten Äußerungen (auf Kosten des Genders) oder eine zu semantisch korrekten Äußerungen (auf Kosten des Genus) besteht.
Dazu werde ich eine Fragebogenstudie vorstellen, bei der 207 Personen Urteile zu Sätzen abgeben sollten, bei denen aufgrund des Kontextes bei der Referenz auf Personen sehr häufig keine Übereinstimmung von Genus und Gender besteht. Einige der Sätze sind ungrammatisch, da das Gender berücksichtigt wird, dies aber vom Genus des Ausdrucks abweicht, andere sind grammatikalisch – also im Hinblick auf das Genus – korrekt, referieren aber auf ein anderes Gender als das der bezeichneten Person.
[...]
2. Gender und Genus in der deutschen Sprache
2.1 Personenbezeichnungen
Neben lexikalischen, sexusinhärenten Ausdrücken (Dame, Mutter, Tochter) bietet das Deutsche verschiedene Möglichkeiten gendergerechter Sprache, wie es Fischer (2004, S. 180) am Beispiel der Berufsbezeichnungen zeigt. So kann das Adjektiv weiblich das Gender kennzeichnen (1a). In der Wortbildung dienen Suffixe wie -in, -euse, -ette, -ess (1b) sowie Komposita mit Zweitgliedern wie -frau, -schwester, -mädchen zur Bildung von Berufsbezeichnungen, die sich auf Frauen beziehen (1c).
(1a) weibliche Lehrkraft
(1b) Lehrerin, Masseuse, Stewardess, Bachelorette
(1c) Kauffrau, Krankenschwester, Zimmermädchen
Vor allem die Derivate, die das Movierungssuffix -in enthalten, werden zur Beidnennung verwendet. Dabei werden sowohl die maskuline als auch die feminine Form koordiniert (2a). Sprachökonomischer ist jedoch das Splitting, bei dem die Genera gleichermaßen markiert werden können mithilfe verschiedener Markierungen (2b). Eine Untersuchung von Adler/Plewnia (2019) zeigt, dass Sprecher*innen bei einer Vorgabe verschiedener Möglichkeiten der Bezeichnung von Personen die neutrale Variante (Studierende) vor der Beidnennung (2a) bevorzugen. Interessanterweise wird die generisch maskuline Form Studenten dem Splitting (2b) vorgezogen.
(2a) Lehrer und Lehrerin, Romanheld oder Romanheldin
(2b) Schüler(in), Schüler/-in, SchülerIn, Schüler_in, Schüler*in, Schüler:in
Die explizit genannten weiblichen Bezeichnungen sind jedoch trotzdem von den männlichen Sprachformen abgeleitet. Dies ist anders bei neutralen Bezeichnungen, die keine Referenz auf das Gender haben. Diese sind entweder inhärent neutral (3a), können aber auch mithilfe von Komposition (3b) oder Konversion (3c) gebildet werden. Im Fall der Derivate muss jedoch auf grammatischer Ebene eine Zuordnung zum Gender vorgenommen werden, da der Artikel je nach Gender variiert und kein neutraler Artikel verwendet werden kann.
(3a) Mensch
(3b) Führungsperson
(3c) der/die Studierende
| Aufruf zur Mitarbeit | 16.06.2023 |
| Autorinnen und Autoren gesucht: Diskutieren Sie mit uns Ihre Fachergebnisse! | |
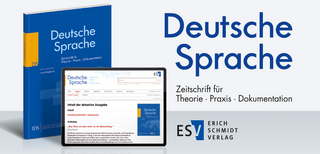 |
Für Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler, die ihre Forschungsergebnisse in einer renommierten Zeitschrift veröffentlichen wollen:Forschen Sie im Bereich der germanistischen Sprachwissenschaft und möchten Ihre Ergebnisse einer breiten Leserschaft zugänglich machen? Werden Sie Teil unseres Autorenteams und reichen Sie uns Ihre exzellenten Beiträge ein! mehr … |
Es stellt sich die Frage, wie die Formen zu verstehen sind, die keine explizite Kennzeichnung der Referenz auf eine weibliche Person enthalten, obwohl eine feminine Form möglich ist. Während in (4a) weibliche Referenten vorliegen, ist unklar, ob es sich in (4b) nur um männliche Referenten handelt, oder ob die Ausdrücke auch weibliche Personen miteinbeziehen.
(4a) Die Lehrerinnen sprechen mit einer Schülerin.
(4b) Die Lehrer sprechen mit einem Schüler.
Dies liegt an der Verwendung des generischen Maskulinums – d. h. „die Verwendung maskuliner Bezeichnungen für unbekannte oder nicht näher spezifizierte Personen“ (Gorny 1995, S. 521) –, welches die Kommunikation erschweren kann; denn wann sind nur Männer gemeint und wann sind auch Frauen mitgemeint? Es gibt keine einheitliche Regel für den Gebrauch des generischen und des tatsächlichen Maskulinums (Stahlberg/Sczesny 2001, S. 132). Becker (2008, S. 71) gibt an, dass die maskulinen Formen dennoch implikatieren, dass es sich um männliche Personen handelt. Dies wurde auch in zahlreichen Assoziationsstudien untersucht (vgl. z. B. neben vielen anderen Braun/Sczesny/Stahlberg 2002; Klein 1988; Stahlberg/Sczesny 2001; Schneider 2020), bei denen Versuchspersonen beispielsweise auf Fragen mit generischem Maskulinum häufig weniger weibliche als männliche Personen nannten. Gefolgert wird aus solchen Studien, dass dem weiblichen Gender ein Nachteil durch die vermeintlich generisch maskulinen Formen entsteht, da diese eben doch nicht immer mitgemeint sind.
Außerdem ist auf der grammatischen Ebene eine generische Interpretation nicht immer möglich. Auch wenn der Ausdruck Lehrer sowohl weibliche als auch männliche Personen meinen kann, ist die Kombination des vermeintlich generisch-maskulinen Ausdrucks mit dem femininen Possessivpronomen inkongruent und daher ungrammatisch.
(5) Der Lehrer unterrichtet *ihre Schüler.
Die Verwendung des maskulinen Possessivpronomens, die an dieser Stelle die einzige grammatisch korrekte Option ist, präsupponiert nach Becker (2008, S. 68) jedoch „das männliche Geschlecht belebter Referenten“, da das Genus „bei Personenbezeichnungen eindeutig semantische Funktion“ hat.
An dieser Stelle stoßen die Bestrebungen eines inklusiven Gebrauchs bei der Referenz auf alle Gender aus grammatischer Sicht an ihre Grenzen, denn grammatisch ist leider nicht alles möglich, was aus sprachinklusiver Sicht vielleicht wünschenswert wäre. Es kommt zu Genus-Gender-Divergenzen.
-----------------------------------------------------------
Falls Sie mehr Beiträge aus der Zeitschrift „Deutsche Sprache“ lesen möchten, können Sie sie hier bequem bestellen. Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre!
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik

