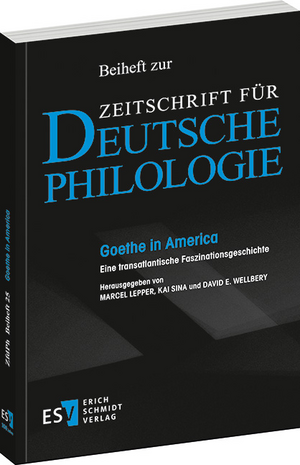Beschäftigen sich mit der amerikanischen Goethe-Rezeption: Marcel Lepper (Foto privat, Fotograf: Chris Korner), Kai Sina (Foto privat, Fotograf: Hans Scherhaufer) und David Wellbery (Foto privat)
Nachgefragt bei Kai Sina, Marcel Lepper und David E. Wellbery
Johann Wolfgang von Goethe gilt nach wie vor als einer der berühmtesten deutschen Dichter und Denker. Sie haben sich in dem neu erschienenen ZfdPh-Beiheft „Goethe in America“ mit der US-amerikanischen Goethe-Rezeption auseinandergesetzt. Was war dabei die zentrale Motivation für Sie, gab es einen spezifischen Aspekt von Goethes Wirkung in den USA?
Kai Sina: Die Goethe-Rezeption findet von Anfang an unter vollkommen anderen Voraussetzungen als in Europa und zumal in Deutschland statt, mit anderen Zielsetzungen und Akzenten. Der Anfangspunkt unserer Auseinandersetzung mit dem Thema, und zwar nicht erst in dem jetzt vorliegenden Band, sondern in Gesprächen und gemeinsamen Projekten über die letzten zehn Jahre hinweg, waren die Schriften Ralph Waldo Emersons. In ihnen begegnet uns Goethe als ein atemberaubend moderner Dichter, der seine Gegenwart in ihrer ganzen Vielfalt und Heterogenität in seinem Werk zu vereinen mochte. Weil er als Künstler und Intellektueller genau das verkörperte, was in der Losung „E pluribus unum“ als soziales Ideal der USA benannt wird, wurde er für US-amerikanische Intellektuelle seit Emerson zu einem der wichtigsten Referenzpunkte. Die Autorinnen und Autoren in unserem Band zeichnen diese Faszinationsgeschichte bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts nach. Den Schlusspunkt bildet Andy Warhol mit seinem Goethe-Porträt, in dem die ironische Brechung des Künstlerkults und die Mythisierung der Ikone Goethe in der kapitalistischen Moderne allerdings unübersehbar ist.
Wie haben sich US-amerikanische Autor/-innen und Intellektuelle historisch mit Goethe auseinandergesetzt? Gibt es wichtige Figuren, die als Brücke zwischen Goethe und der amerikanischen Literaturgeschichte fungieren?
Kai Sina: Zunächst darf die Bedeutung der Vermittlung Goethes über England nicht unterschätzt werden. Übersetzer wie Thomas Carlyle spielten eine entscheidende Rolle dabei, Goethes Werke und Ideen einem englischsprachigen Publikum zugänglich zu machen. Carlyle selbst pflegte einen brieflichen Austausch mit Goethe und beeinflusste damit auch Intellektuelle in den USA. Unter ihnen ist neben Emerson vor allem Margaret Fuller zu nennen, die ebenfalls zum Kreis der Transzendentalisten gehörte. In ihrem Buch „Woman in the Nineteenth Century“ von 1845 legt sie ihr Augenmerk auf die Frauenfiguren in Goethes Werk und Biografie, um von ihnen ausgehend ihre feministischen Standpunkte zu formulieren, die immer noch von verblüffender Gegenwärtigkeit sind. Sie geht dabei so weit, nicht nur die gleichgeschlechtliche als eine gleichberechtige Form der Liebe zu beschreiben, sondern darüber hinaus die Fluidität der Geschlechter zu benennen. Außerdem darf Walt Whitman nicht unerwähnt bleiben, der Goethe zwar auch selbst liest, ihn aber vor allem indirekt über Emerson wahrnimmt. Sein Selbstverständnis als demokratischer Autor, das sich in dem Satz „I contain multitudes“ ausdrückt, lässt sich auf Goethes späte Selbstbeschreibung als „Kollektivwesen“ zurückführen, auf die wiederum Emerson in seinen Schriften mehrfach rekurriert.
| Auszug aus „Goethe in America. Eine transatlantische Faszinationsgeschichte“ |
17.02.2025 |
| Die Wiederbelebung Goethes in Amerika |
 |
Eine knapp 100 Jahre alte letzte Ausgabe, Unverfügbarkeit und Lieferengpässe sowie unterschiedliche Übersetzungen einzelner Werke, dies war die traurige Stellung Goethes in den USA im 19. Jahrhundert – bis der Verleger Siegfried Unseld 1980 die Idee hatte, diesen Zustand mit einer amerikanischen Goethe-Ausgabe zu ändern. Dabei war der Wunsch dieser Publikation nicht allein, dem amerikanischen Lesepublikum den deutschen Dichter näherzubringen, sondern ebenfalls den amerikanischen Buchmarkt künftig besser zu verstehen. Auch wenn die Goethe-Ausgabe kein Bestseller wurde, so kann man das Projekt dennoch als eine geglückte „transatlantische Verständigung […] in Buchform“ ansehen. Lesen Sie hier einen Auszug aus Sarah Nienhaus‘ Beitrag in unserem neuen Band „Goethe in America“ über die amerikanische Goethe-Ausgabe des Suhrkamp-Insel Verlags. mehr … |
Die US-amerikanische Goethe-Rezeption erschließt sich darin aber nicht.
David Wellbery: Nein, die Goethe-Rezeption in den USA zeigt eine erstaunliche Vielfalt und Beständigkeit, die bis ins zweite Drittel des 20. Jahrhunderts reicht. Bislang weitgehend unbeachtet ist etwa die afroamerikanische Perspektive, die Werner Sollors in unserem Band ausführlicher vorstellt. Besonders eindrucksvoll ist die „farbenblinde“ Aufführung von Goethes „Faust“ 1978 im La MaMa Theater in New York. Sie wurde von Fritz Bennewitz inszeniert, dem ehemaligen Intendanten des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Besondere Aufmerksamkeit erregte Christine Campbell, eine afroamerikanische Schauspielerin, die Gretchen spielte. An Beispielen wie diesen zeigt Werner Sollors in seinem Beitrag, dass und wie Goethes Werk über ethnische und soziale Grenzen hinweg wahrgenommen und künstlerisch produktiv wurde.
Ein anderer Beitrag beschäftigt sich mit dem Versuch Siegfried Unselds, in den frühen 1980er Jahren eine eigens für den US-amerikanischen Buchmarkt gestaltete Goethe-Ausgabe zu etablieren. Warum ist dieser Versuch letztlich gescheitert?
Marcel Lepper: Das Projekt der US-amerikanischen Goethe-Ausgabe scheiterte vor allem an einer fehlenden Marktkenntnis und den strukturellen Herausforderungen des amerikanischen Buchmarkts. Suhrkamp wollte Goethe in einer popkulturell ansprechenden und wissenschaftlich hochwertigen Form präsentieren, unterschätzte jedoch die Schwierigkeiten, ein breites Publikum in den USA zu erreichen. Hinzu kamen hohe Kosten für Übersetzungen und Produktion, die sich durch die geringen Verkaufszahlen nicht amortisieren ließen. Das Vorhaben war als Prestigeprojekt gedacht, das Suhrkamp im transatlantischen Raum etablieren sollte, konnte aber die angestrebte Wirkung nicht entfalten. Letztlich blieb die Ausgabe ein akademisches Nischenprodukt mit begrenztem Erfolg.
Welche Werke Goethes sind in den USA Ihrer Meinung nach am meisten prägend oder bekannt und welche Relevanz hat Goethes Werk heute noch für die amerikanische Gesellschaft?
David Wellbery: Mit der Entstehung des Transzendentalismus zu Beginn des 19. Jahrhundert wurden Goethes Werke, insbesondere „Faust“, von Emerson und Fuller für philosophische und gesellschaftliche Fragen neu interpretiert. Den Höhepunkt der US-amerikanischen Goethe-Rezeption bildet eine riesige internationale Konferenz in Aspen 1949, auf der Goethes Humanismus für die Nachkriegswelt vergegenwärtigt werden sollte. Etwas Vergleichbares hat es in den USA danach nicht wieder gegeben. In den 1980er Jahren blickt Saul Bellow, in seinem Roman „More Die of a Heartbreak“, im Modus satirischer Brechung auf die amerikanische Goethe-Faszination zurück. Nicht zu vergessen ist allerdings die rege akademische Goethe-Forschung in Nordamerika, von der bis heute wesentliche Impulse ausgehen.
Zum Abschluss: Warum ist Goethe für die US-amerikanische Gesellschaft noch immer relevant?
Marcel Lepper: Goethe bleibt aktuell, nicht nur in den USA, weil sein Werk universelle Fragen anspricht, Fragen der Humanität, der Vielfalt und Liberalität, des modernen Daseins überhaupt. Gerade in einer zunehmend polarisierten Welt wie der unseren können seine Ideen Orientierung geben. Goethes Begriff der Weltliteratur und überhaupt seine produktive Rezeption unterschiedlicher literarischer Traditionen sind heute wichtige Vorbilder literatur- und kulturwissenschaftlicher Forschungen. Von großer Relevanz ist auch Goethes ganzheitliche Naturauffassung, die für die ökologische Diskussion von großer Bedeutung ist. Schließlich zeigt sich an seinem Beispiel, wie literarische Traditionen transatlantische Brücken schlagen können – was heute vielleicht so nötig ist wie nach dem Zweiten Weltkrieg lange nicht mehr.
Lieber Herr Lepper, lieber Herr Sina, lieber Herr Wellbery: haben Sie herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Interview!
Wenn es Sie, liebe Leserinnen und Leser, interessiert, den Band zu lesen und zu erwerben, dann finden Sie alle relevanten Informationen hier:
| Die Herausgeber |
Kai Sina, Professor für Neuere deutsche Literatur und Komparatistik (mit dem Schwerpunkt Transatlantische Literaturgeschichte) an der Universität Münster, Herausgeber des Bandes „Goethes Spätwerk / On Late Goethe“ (mit David E. Wellbery) und der Studie „Kollektivpoetik“ mit Studien zu Goethe, Emerson, Whitman und Thomas Mann.
Marcel Lepper, Professor an der Universität Leipzig und Direktor der Fondation Rilke, VS, Schweiz, Autor u.a. der Studie „Goethes Euphrat“ (2016) und Herausgeber der „Xenien“ Goethes und Schillers (2022, mit Frieder von Ammon).
David E. Wellbery, LeRoy T. and Margaret Deffenbaugh Carlson University Professor in the Department of Germanic Studies an der University of Chicago, zahlreiche einschlägige Veröffentlichungen, darunter das Standardwerk „The Specular Moment. Goethe’s Early Lyric and the Beginnings of Romanticism“ (1996) und zuletzt „Goethes ‚Pandora‘. Dramatisierung einer Urgeschichte der Moderne“ (2017). |
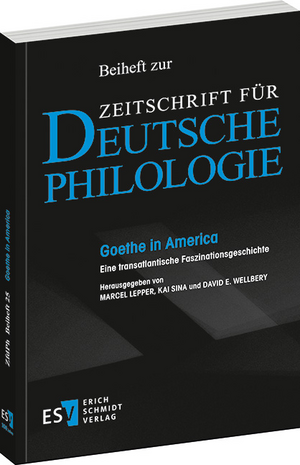 |
Goethe in America
Herausgegeben von: Marcel Lepper, Kai Sina, David E. Wellbery
Goethe fungierte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein als ein Nationalschriftsteller der USA. Die Rezeption beginnt bei den Transzendentalisten um Ralph Waldo Emerson und Margaret Fuller, wird ausgeformt in der US-amerikanischen Literatur der Jahrhundertwende und neu akzentuiert durch die Autorinnen und Autoren, die nach 1933 aus Deutschland in die USA emigrierten. Die Aufsätze in diesem Band fragen nach den literarischen wie ideengeschichtlichen Wechselverhältnissen und rekonstruieren im Zusammenspiel eine transatlantische Faszinationsgeschichte.
|