
Keine Steuerbefreiung für die Veräußerung eines Gartengrundstücks
Abtrennung einer Gartenfläche vom Wohngrundstück
Die Kläger waren Eigentümer eines Grundstücks, das mit einem von Ihnen selbst bewohnten Haus und großen Außenflächen, dies sie als Garten nutzten, versehen war. In zeitlichem Zusammenhang mit Verkaufsgesprächen veranlassten die Kläger die Teilung ihres Grundstücks, so dass hieraus zwei Flurstücke entstanden, von denen nur noch eines mit dem Wohnhaus bebaut war. Das andere Flurstück veräußerten die Kläger.
Das Finanzamt besteuerte den Veräußerungserlös als privates Veräußerungsgeschäft nach § 22 Nr. 2, § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Der hiergegen eingelegte Einspruch und die Klage blieben im Wesentlichen ohne Erfolg
Identität der Wirtschaftsgüter beim privaten Veräußerungsgeschäft
Ob und in welchem Umfang Nämlichkeit gegeben ist oder ein anderes Wirtschaftsgut ("aliud") vorliegt, richtet sich nach einem wertenden Vergleich von angeschafftem und veräußertem Wirtschaftsgut unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls.
Maßgebliche Kriterien sind die Gleichartigkeit, Funktionsgleichheit und Gleichwertigkeit von angeschafftem und veräußertem Wirtschaftsgut. Die Nämlichkeit der Wirtschaftsgüter war hier zu bejahen, da die aus der Teilung des Gesamtflurstücks hervorgegangenen Teilflurstücke zwar unterschiedlich groß sind, sich aber ansonsten in ihrer Art, Funktion und Wertigkeit nicht voneinander unterscheiden.
Eigene Wohnnutzung als Ausnahmetatbestand
Ertragsteuerlich bilden das Wohngebäude und der dazugehörende Grund und Boden unterschiedliche Wirtschaftsgüter. Begrifflich kann nur das Wohngebäude zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden.
Gleichwohl erstreckt sich die Ausnahme auch auf den Grund und Boden, auf dem das Wohngebäude steht, soweit ein einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang zwischen der Nutzung des Gebäudes zu eigenen Wohnzwecken und der Nutzung des Grundstücks (zum Beispiel als Garten) besteht.
Dieser Zusammenhang muss grundsätzlich im Zeitpunkt der Veräußerung noch vorliegen, was im Streitfall aufgrund der Teilung in verschiedene Flurstücke nicht mehr gegeben war. Damit ist die frühere Nutzung nicht mehr von Bedeutung. Die Veräußerung des Flurstücks „Garten“ unterliegt als privates Veräußerungsgeschäft der Besteuerung.
Quelle: BFH, Urteil vom 26.09.2023 - IX R 14/22, veröffentlicht am 25.09.2024
| Bei uns bleiben Sie auf dem aktuellen Stand im Bereich Steuern. |
| Abonnieren Sie doch gleich hier unserem kostenlosen Newsletter Steuern. |
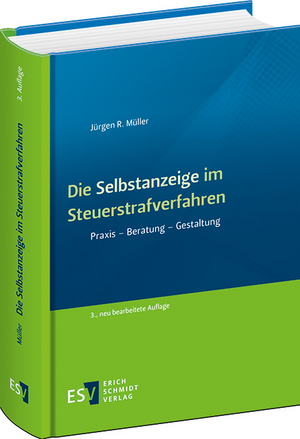 |
Die Selbstanzeige im Steuerstrafverfahren von Jürgen R. Müller
Die strafbefreiende Selbstanzeige gilt mit ihren oft weitreichenden persönlichen Folgen als besonders beratungsintensiv. Im Zuge der Intensivierung des Kampfes gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuervermeidung müssen sich auch Unternehmen heute umfassend mit den entsprechenden Vorschriften und wachsenden Entdeckungsrisiken befassen. Mit einer rechtswirksamen Selbstanzeige kann die Brücke zur Straffreiheit erfolgreich beschritten werden.
Die aktualisierte 3. Auflage des leicht verständlichen Ratgebers zeigt Ihnen solide Beratungsansätze für alle typischen Anwendungs- und Risikobereiche des Rechts der Selbstanzeige auf. |
(ESV/cm)
Programmbereich: Steuerrecht
