
Maximiliane Stöckel: „Nicht alles, was sich jemand in Brüssel unter der Dusche überlegt, muss in ein Gesetz einfließen“
Die Gründe dafür sind vielfältig. Da ist zum einen der Wandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft. Marken kennzeichnen Produkte, die sich durch einen Eigenschaftskatalog auszeichnen. Damit wird die Marke zum Informationsträger. Marken erlauben dem Anbieter, sich von seinen Konkurrenten zu unterscheiden, ermöglichen eine Wiedererkennung und machen das Produkt unverwechselbar. Zum anderen ist aufgrund der Globalisierung der Märkte eine regionale Ausdehnung der Marken gegeben. Die seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu beobachtende verstärkte internationale Arbeitsteilung veranlasst Unternehmen, ihre Aktivitäten länderübergreifend zu planen, umzusetzen und zu kontrollieren. Vor diesem Hintergrund sind die sog. Global Brands (Weltmarken) als Ausdruck einer internationalen Markenstrategie entstanden.
| Zur Person |
| Maximiliane Stöckel war bis 2017 Partnerin und bis Ende 2023 Of Counsel der internationalen Anwaltssozietät Bird & Bird und ist eine erfahrene Expertin im Markenrecht. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit bildeten dabei die zentrale Steuerung und Kontrolle marken- und designrechtlicher Vorgänge im In- und Ausland sowie das Management globaler IP Portfolia. Maximiliane Stöckel hält zudem Vorträge über Themen zu Marken- und Designschutz sowie IP Portfolio Management. Sie ist auch als Mediatorin tätig. |
Was waren die Meilensteine bei der Entwicklung dieses Rechtgebietes?
In Deutschland war dies sicher die Änderung der Rechtslage im Jahr 1992. Bis zum 30.04.1992 bestand ein Grundsatz des Kennzeichengesetzes, basierend auf dem damals geltenden Warenzeichenzeichengesetz, darin, dass eine Bindung des Warenzeichens (heute: Marke) an den Geschäftsbetrieb des Rechtsinhabers bestand (sog. Akzessorietät).
Das Warenzeichen stellte zu diesem Zeitpunkt kein selbständiges Vermögensrecht dar und konnte nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb verkauft und übertragen werden. Ein isolierter bilanzieller Wertansatz eines Warenzeichens war damals völlig irrelevant.
Das nach der Wiedervereinigung Deutschland in Kraft getretene Erstreckungsgesetz hob die rechtliche Verbindung von Geschäftsbetrieb und Warenzeichen durch Änderung des Warenzeichengesetzes auf (in der DDR gab es eine solche Bindung nicht). Damit wurde das Warenzeichen zu einem selbständigen Vermögensrecht. Eine rechtsgeschäftliche Übertragbarkeit losgelöst vom zugrundeliegenden Geschäftsbetrieb wurde möglich und damit auch die Voraussetzungen für eine gesonderte bilanzielle Erfassung.
Mit Wirkung zum 01.01.1995 wurde das Warenzeichengesetz abgeschafft und durch das Markengesetz ersetzt. Für eine Anmeldung bzw. den Besitz einer Marke ist seither kein Geschäftsbetrieb mehr erforderlich, sondern lediglich die Rechtsfähigkeit des Anmelders bzw. Inhabers.
Neben dem Imagegewinn haben Marken oft auch einen monetären Wert. Beispielsweise bemisst die Organisation „Best Global Brands“ die Marke „Apple“ mit 482 Mrd USD. Wie lässt sich der Wert einer Marke messen?
Für den Begriff des Markenwertes gibt es bisher keine einheitliche, allgemein akzeptierte Definition. Die Vielzahl von Definitionsversuchen des Markenwertes lässt sich in finanz- (Markenwert als monetäre Kerngröße) und konsumorientierte (der Konsument wird als Quelle des Markenwertes festgelegt) Markenwertbegriffe kategorisieren.
Auch hinsichtlich der Bemessung des Wertes gab und gibt es unterschiedliche Ansätze. In den Jahren 1950-1990 herrschten funktionsorientierte Markenbewertungsmodelle vor, die auf konkreten und finanzorientierten Fragestellungen basierten. Seit 1990 baute die Markenbewertung eher auf einem differenzierten Markenverständnis auf und versucht den Wert umfassend und losgelöst von zugrundeliegenden Funktionen zu bestimmen.
Diese kontroversen Diskussionen haben insoweit Früchte getragen, als ein Standard entstanden ist, nämlich ISO10668 „requirements for monetary brand valuation“. Sie ist keine Verfahrensanleitung im engeren Sinne, legt aber Mindeststandards fest, die zu einer Vereinheitlichung der Bewertungsergebnisse führen soll. Sie lässt ausreichend Spielraum für den Bewerter, die individuellen Besonderheiten der Marke zu berücksichtigen, wie z.B. Markenart, Bewertungsanlass oder Datenbasis. Ein normkonformes Markenbewertungsprojekt läuft in verschiedenen Phasen ab, die zwingend durchlaufen werden müssen (Messung der Markenstärke und der Markenrelevanz; Isolierung der Markenleistung; Ermittlung des Markenertragspotenzials; Ermittlung der Lebensdauer der Marke; Barwerterrechnung).
Marken sind auch anfällig für Verluste. Was lässt sich dagegen tun?
Sind Produktfälschungen oder Nachahmungen vorhanden, die die Produktsicherheit gefährden und damit direkt auf die Wertschätzung der eigenen Marke negativen Impact haben?
Proaktiv etabliertes Krisenmanagement, das im Ernstfall sofort greift. Beispiel „Germanwings Katastrophe“: Lufthansa hat unmittelbar nach dem Vorfall die – zwar ohnehin geplante aber noch nicht in Vollzug gesetzte – Ablösung von Germanwings durch Eurowings in Gang gesetzt, so dass die durch den Vorfall negativ konnotierte Bezeichnung Germanwings mehr oder weniger ad hoc ausgewechselt werden konnte. Frühzeitige Anpassung von Marken an Entwicklungen im Markt ohne Brüche und ohne den Markenkern aufzugeben. Eine professionelle Markenstrategie setzt dabei auf eine langsame, aber stetige Weiterentwicklung, ohne dabei das Profil – die Kernkompetenz – der Marke zu verlieren.
Für welche Markenform ist es nach Ihrer Auffassung am schwierigsten eine Eintragung zu erlangen?
Unabhängig von der Geruchsmarke (siehe unten), sehe ich bei der konturlosen Farbmarke immer noch die größten Schwierigkeiten: die Farbe muss per se als Herkunftshinweis wirken, sie muss also beim angesprochenen Verkehr als Kennzeichnungsmittel verstanden werden. Ohne Verkehrsdurchsetzung (Zuordnungsgrad von mindestens 50%) wird dies erfahrungsgemäß unwahrscheinlich sein.
Die Recherche ist eine wesentliche Vorarbeit vor einer Markenanmeldung. Sehen Sie hierfür künftig Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI)?
Auf jeden Fall für die Durchführung einer Recherche. Eine Recherche wird aufgrund vorab eingestellter Parameter (Recherchekriterien) durchgeführt (z.B. identisches Präfix oder Suffix eines Wortes; phonetische Ähnlichkeiten aufgrund Anzahl und Abfolge von Vokalen und Silben). Diese Parameter werden auch jetzt schon von Rechercheinstituten automatisiert benutzt und nicht mehr jeweils im Bedarfsfall manuell eingestellt.
Bei der Auswertung des Rechercheergebnisses ist zu unterscheiden: Der Grad der Übereinstimmung mit aufgefundenen Marken wird bereits jetzt „automatisch“ generiert (z.B. 100% Übereinstimmung bei vollständiger Identität, absteigend dann je nach Grad der Übereinstimmung bzw. fehlenden Übereinstimmung).
Bei der juristischen Evaluierung, der Frage also, ob eine Übereinstimmung bzw. in welchen Bestandteilen eine Übereinstimmung dann tatsächlich zu einer Verwechslungsgefahr führt (und ob diese eine unmittelbare oder mittelbare ist), wird üblicherweise auf die aktuelle Spruchpraxis zurückgegriffen. Die KI könnte hierbei auf die bestehenden Datenbanken zurückgreifen und die im Einzelfall zutreffende Entscheidung herausfinden und anwenden.
Allerdings hängt die Evaluierung auch von einer Kenntnis des jeweiligen Umfeldes ab, in dem sich die sich gegenüberstehenden Marken bewegen, sowie von Präzedenzfällen, die konkret einschlägig sind (oder weiteren Faktoren, wie z.B. der Historie der Marken); Kriterien also, die der KI so nicht zugänglich sind.
Fazit: für die Prüfung auf der „objektiven“ Ebene (Faktencheck) einer Recherche ist der Einsatz von KI denkbar, auf der „subjektiven“ Ebene (Gewichtung/Abwägung einzelner Kriterien) noch unwahrscheinlich.
Können Sie uns einmal mitteilen, warum es so viele Judikate gebraucht hat, um die Markenrechte am Lindt Goldschokohasen abschließend zu klären?
Zunächst zur Klarstellung: Es handelte sich hier sowohl um einen Streit um Markenrechte am Schokohasen, als auch um die Durchsetzung von diesen Markenrechten. Im Übrigen gab es unterschiedliche Verfahren, mit unterschiedlichen Beteiligten und die Verfahren zogen sich jeweils über mehrere Instanzen, bis hin zum EuGH bzw. BGH.
Damit erklärt sich der zeitliche Rahmen. Lindt & Sprüngli als Hersteller/Vertreiber der Goldhasen hat geschützte Markenrechte. Eine Eintragung des Hasen in Goldfolie als dreidimensionale Marke scheiterte aber mangels Unterscheidungskraft letztinstanzlich vor dem EuGH (= Streit um ein Markenrecht).
Neben dem Streit um die Markeneintragung führte Lindt einen Prozess gegen Riegelein, die einen ähnlichen Hasen in Goldpapier verkauften (= Durchsetzung von Markenrechten). Der Rechtstreit ging zugunsten Riegelein aus. Der BGH war der Auffassung es bestünde keine Verwechslungsgefahr zwischen dem sitzenden Hasen in Goldfolie von Riegelein und dem Goldhasen von Lindt.
Daraufhin änderte Lindt seine Strategie und stützte sich auf die Bekanntheit des Goldtones und somit auf Rechte aus einer Benutzungsmarke, was zunächst wegen mangelnder Verkehrsgeltung vom OLG München abgelehnt wurde. Am 29. Juli 2021 erging dann in einem Verfahren gegen das Unternehmen Heilmann die Entscheidung des BGH. Lindt habe nachgewiesen, dass der Goldhase innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung für Schokohasen erlangt hat. Der nachgewiesene Zuordnungsgrad von 70% übersteige die erforderliche Schwelle von 50% deutlich.
| Markenschutz für Farbton | 29.07.2021 |
| BGH: Etappensieg für Lindt – Goldton des Osterhasen als Benutzungsmarke geschützt | |
 |
Der Goldhase der Unternehmensgruppe Lindt & Sprüngli hat schon öfter die Gerichte beschäftigt. So bemühte sich der Süßwarenhersteller jahrelang erfolglos um einen Schutz des Hasen als dreidimensionale Marke. Dieses Mal musste der BGH darüber entscheiden, ob der Goldton des Osterhasen Markenschutz beanspruchen kann. mehr … |
Stichwort Geruchsmarken: Wie bei allen Markentypen (Wort-/Bildmarke, Wortmarke, Bildmarke, Farbmarke, Hörmarke) muss auch bei der Geruchsmarke Unterscheidungskraft für die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen gegeben sein. Wie gelingt hier am besten die „graphische Darstellbarkeit“?
Zur Klarstellung: Aufgrund der Neufassung des § 8 Absatz 1 MarkenG entfällt das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit. An seine Stelle tritt das Erfordernis, dass der Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmbar sein muss. Eine Geruchsmarke muss somit mit Hilfe der technisch verfügbaren Mittel ausreichend präzise und zugänglich sein.
Dem EuGH reicht eine chemische Struktur bzw. Summenformel nicht aus, weil nicht verständlich genug. Eine Beschreibung des Geruches ist nicht klar, eindeutig und objektiv genug, eine Geruchsprobe nicht dauerhaft. Die Zurückweisung einer chemischen Formel halte ich für sehr zweifelhaft. Immerhin definiert sie den Stoff eindeutig, auch wenn er unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Allerdings hat die Geruchsmarke derzeit noch eine sehr geringe praktische Bedeutung, so dass abzuwarten ist, welcher Weg sich dann letztendlich in der Zukunft durchsetzen wird.
In zahlreichen Unternehmen gibt es Abteilungen, die mit Markenangelegenheiten betraut sind. Welche Rolle spielen dabei die Markenstrategien?
Aufgabe der Marke ist es, eine eigene-, Empfindungs- und Wertegemeinschaft, eine Brand Community, herauszubilden. Und das geht nur mit einem klaren Profil.
Marken sollen nicht nachmachen, sondern vorgeben. Sie geben in einer instabilen, sich stetig verändernden Welt Orientierung und Halt. In der Flut der visuellen Reize rettet uns nur eine selektive Wahrnehmung.
Dafür benötigen Marken klare Leitlinien und Weichen – also Strategien – die es möglich machen, die Marke zu entwickeln. Für eine erfolgreiche Markenführung ist es auch von zentraler Bedeutung, den Wandel im Konsumverhalten zu erkennen.
Marken sind ein lebendes System, das dadurch erfolgreich ist und bleibt, wenn man sich auch einmal von vertrauten Mustern abkehrt, also eine frühzeitige Anpassung an Entwicklungen einleitet, aber ohne Brüche und ohne die eigene Identität aufzugeben.
In der Anpassung muss der Kern der Marke unverändert bleiben. Und das funktioniert nur mit einer etablierten Strategie, denn Marken fallen nicht vom Himmel, sondern werden gemacht – und zwar nicht von heute auf morgen.
Es bedarf Schlüsselregeln für die Marke; diese sind unumstößlich und dürfen auf keinen Fall untergraben werden. Sie sorgen für eine kontinuierliche Markenführung in einer Welt, in der sich permanent alles verändert.und warum sind diese Chefsache? Markenführung ist nicht nur eine Aufgabe der Kommunikation, sondern wirkt sich auf das ganze Unternehmen aus. Inhaber oder dem Unternehmen eng verbundene Manager denken langfristiger, als ferner stehende Berater. Sie haben den notwendigen langen Atem für den Aufbau einer Markenpersönlichkeit. Sie sehen das große Ganze und denken nicht in kurzen Zeitspannen.
Ein solch autokratischer Umgang mit der Marke schließt das Delegieren von Markenführung aus. Berater denken hingegen eher kurzfristig und egoistisch; sie schätzen den eigenen Erfolg höher ein als den Markenerfolg. Eine Marke zu etablieren, fordert Mut zum Risiko und verlangt manchmal auch unpopuläre Entscheidungen, die ausschließlich in der Chefetage getroffen werden können.
Eine besondere Bedeutung hat in den letzten Jahre auch das Design erlangt. Was hat sich hier grundlegend geändert?
Unter Geltung des GeschmacksmusterG a.F. bestand eine nahe Verwandtschaft des Geschmacksmusters zu Werken der angewandten Kunst und das Verhältnis zueinander sollte durch einen rangmäßigen und gradmäßigen Unterschied geprägt sein. Dieser sog. copyright approach wurde durch den design approach abgelöst. Bereits im Jahr 2004 wurde dies durch die Änderung der Gesetzesbezeichnung von GechmacksmusterG zum Ausdruck gebracht und durch die durch die letzte Gesetzesänderung vollzogene Umbenennung in DesignG bestätigt. Das DesignG beinhaltet zum einen eine terminologische Neuausrichtung: Schutzgegenstand ist nicht mehr das Muster, sondern das Design und dieser Schutz wird nicht mehr durch das Geschmacksmuster, sondern durch das eingetragene Design gewährt. Zum anderen wurde neben weiteren Neuerungen ein amtliches Nichtigkeitsverfahren eingeführt. Früher war ausschließlich eine Klage vor den ordentlichen Gerichten notwendig.
| Der kostenlose Newsletter Recht – Hier können Sie sich anmelden! |
| Redaktionelle Meldungen zu neuen Entscheidungen und Rechtsentwicklungen, Interviews und Literaturtipps. |
Voraussichtlich im Frühjahr 2024 erscheint im Erich Schmidt Verlag Ihr Handbuch „Marken- und Designrecht“ in der vierten, völlig neu bearbeiteten Auflage. An wen richtet sich dieses Werk?
Es richtet sich an Juristen und Nicht-Juristen, die mit Marken und Designs (Schutz, Erhalten, Durchsetzen und Führen) zu tun haben – sowohl temporär (also nur von Zeit zu Zeit), als auch schwerpunktmäßig. Und was zeichnet das Handbuch aus? Es gibt komprimiert die aktuelle Rechtslage wieder und lässt gleichzeitig die praktische Erfahrung der Autoren einfließen.
Mit seinem interdisziplinären Ansatz weitet es auch den Blick in Richtung Ökonomie der Marke aus. Zu nennen sind hier die Markenbewertung oder das Markenmanagement. Das macht den Unterschied zu rein juristischen Werken, sodass wir auch nichtjuristische Zielgruppen ansprechen.
Welche weiteren verwandten Rechtsgebiete behandelt es?
Das Werk geht auch auf die – nicht zu unterschätzende – Produktpiraterie ein. Welche speziellen Instrumente zur Bekämpfung stehen den Rechteinhabern hier zur Verfügung?
Frühzeitige und kontinuierliche Marktüberwachung (Schaffung von Awareness bei den eigenen Mitarbeitern; Einrichtung institutioneller Überwachung durch darauf spezialisierte Dienstleister). Frühzeitiges und konsequentes Vorgehen gegen Verletzer (einstweilige Verfügungen, Klagen. Besonders nachahmungsintensive Länder stellen mittlerweile auch kostengünstige Amtsverfahren zur Verfügung). Ein juristisches Vorgehen wirkt nicht nur gegen den angegriffenen Verletzer, sondern kann auch abschreckend potentiellen Verletzern gegenüber wirken. Grenzbeschlagnahme (=zollbehördliche Zurückhaltung von möglicherweise schutzrechtsverletzendes Waren bei offensichtlicher Schutzrechtsverletzung bzw. einem bloßen Verdacht). Der Inhaber eines Schutzrechtes kann beim Zoll einen Antrag auf Grenzbeschlagnahme stellen, um die Einfuhr solcher Waren zu verhindern
Ihr Ausblick: Wo geht die weitere Entwicklung hin? Stichwort Digitalisierung als 4. Industrielle Revolution. Welchen Einfluss wird die Digitalisierung auf die Entwicklung, Führung und Definition von Marken haben?
Ich sehe hier einen Wandel von der Einweg- zur Dialogkommunikation. Zudem werden Konsumenten – die durch digitale Medien besser informiert sind – Teil eines co-kreativen Entwicklungsprozesses von Marken sein. Die Marke entwickelt sich also vom juristischen Schutzrecht hin zu einer Plattform, derer sich verschiedene Bezugsgruppen bedienen, mit neuen Markenmodellen für digitale Marken.
Die Digitalisierung und der Einfluss von AR und VR nehmen bereits jetzt großen Einfluss auf den Kaufprozess. Aspekte wie Material, Haptik und Qualität treten zurück. Damit kann die Marke an Wirkung verlieren, wenn nur noch aufgrund des projizierten Bildes die Kaufentscheidung fällt. In einer solchen Welt kann nur noch eine starke Marke gewinnen, eine Marke, die in beiden Welten -der physischen und der virtuellen- optimal aufgestellt ist.
Gibt es noch Lücken, die der Gesetzgeber schließen sollte?
Lücken sehe ich derzeit nicht. Im Gegenteil: Wir haben innerhalb der drei vergangenen Jahrzehnte mehrere Änderungen gehabt. Jetzt sollte sich die Rechtslage konsolidiert haben und weitere Reformvorschläge – insbesondere aus Brüssel – sehe ich durchaus als entbehrlich an. Es muss nicht alles, was sich jemand in Brüssel unter der Dusche überlegt, in ein Gesetz einfließen.
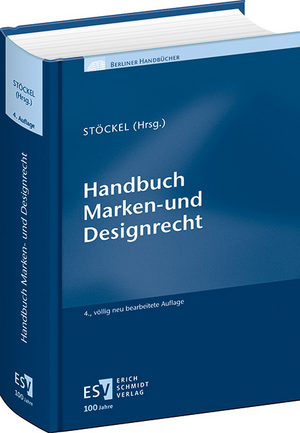 |
Eine Marke für sich Handbuch Marken- und DesignrechtHerausgegeben von: Maximiliane Stöckel – Erscheinungstermin: 01.03.2024 Das Marken- und Designrecht hat sich längst zu einem industriepolitischen Instrumentarium von überragender Bedeutung entwickelt. Ob Etablierung, Pflege, Durchsetzung und Verteidigung von Marken oder auch grundlegende Bewertungs- und Führungsfragen: Markenstrategie ist „Chefsache“ und ein kritischer Erfolgsfaktor in jedem Unternehmen.
Alle Autorinnen und Autoren sind durch langjährige Einblicke in die unternehmerische Praxis mit der Thematik bestens vertraut. |
| Verlagsprogramm | Weitere Nachrichten aus dem Bereich Recht |
(ESV/bp)
Programmbereich: Wirtschaftsrecht
