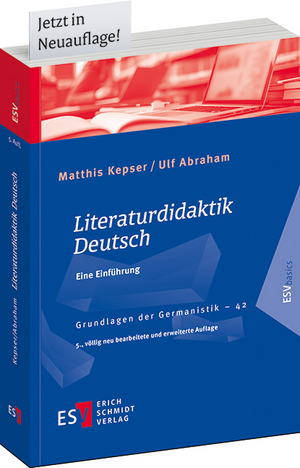„Mit Künstlicher Intelligenz kommen viele Lern- und Prüfungsaufgaben auf den Prüfstand, nicht zuletzt solche für den Literaturunterricht.“
Lesen Sie hier ein Interview mit den beiden Autoren:
Lieber Herr Kepser, lieber Herr Abraham, Ihr Buch „Literaturdidaktik Deutsch“ erscheint nun bereits in der 5. Auflage und gilt zu Recht als eines der Standardlehrwerke des Fachs. Was haben Sie für die Neuauflage überarbeitet, was wurde ergänzt, was wurde gekürzt oder gar gestrichen?
Matthis Kepser / Ulf Abraham: Alle Kapitel wurden gründlich überarbeitet, das bisher dritte sogar ganz neu geschrieben und an den Schluss gerückt. Da sich empirisches Arbeiten auch in der Literaturdidaktik durchgesetzt hat und die Zahl der Studien ständig wächst, stellen wir nicht mehr einzelne Arbeiten vor, sondern erklären empirische Forschungsmethoden in ihrer Bedeutung für das Fach.
Im ganzen Buch gestrichen wurden Bezugnahmen auf überholte Fachliteratur; nach Möglichkeit ersetzt haben wir Unterrichtsbeispiele, die mit nicht mehr erhältlichen Lektüren arbeiten.
Ergänzt haben wir neue Konzepte wie etwa das literarische Schreiben und Ausführungen zu sich weiterentwickelnden Genres wie der Hörliteratur, dem Comic und digitalen Spielen. Damit unterstützen wir nachdrücklich den Weg, den die neuen KMK-Standards (einfacher und mittlerer Schulabschluss) für den Literaturunterricht eingeschlagen haben. An verschiedenen Stellen gehen wir auf die aktuelle und künftige Rolle KI-gestützter Programme im Literaturunterricht ein.
Sie sprechen in der Einführung immer wieder von „Literatur als kultureller Praxis“. Können Sie bitte unseren LeserInnen und Lesern erläutern, was Sie darunter verstehen?
Matthis Kepser / Ulf Abraham: Es geht im Literaturunterricht und in der literaturdidaktischen Forschung nicht nur um Autoren und Autorinnen sowie deren Werke. Literatur als kulturelle Praxis umfasst alle auf die Produktion, Rezeption, Illustration, mediale Adaption und Verbreitung literarischer Texte bezogenen Verfahren und Tätigkeiten. Dazu gehören auch Formen der Anschlusskommunikation wie das literarische Gespräch und die Literaturkritik. Für all das gibt es professionelle Akteure und Akteurinnen, deren Handeln Maßstäbe setzt. Aber wir müssen auch das im Blick haben, was Laien leisten können, beispielweise auf Fanfiction-Plattformen im Netz. Kurz: Zu dieser Praxis gehört alles, was dem Hervorbringen, der Aneignung und Weiterentwicklung von Literatur dient, und was diese im kollektiven Gedächtnis einer Kultur lebendig hält.
Ein Anliegen des Buchs ist es, Literatur in allen medialen Formen als Gegenstandsbereich des Literaturunterrichts zu behandeln. Welche Medien sind damit gemeint?
Matthis Kepser / Ulf Abraham: Die neuen KMK-Bildungsstandards bezeichnen den für uns relevanten Gegenstandsbereich mit „Literatur in unterschiedlicher Medialität“. Damit erweitern sie das Handlungsfeld auf alle Medien, die erzählend, darstellend und beschreibend der fiktionalen Weltwahrnehmung und -deutung dienen können. Analog zum erweiterten Textbegriff und -verständnis rücken so auch explizit multimodale literarische Formen in den Blick. Diesen Ansatz haben wir im Prinzip schon in früheren Auflagen verfolgt, wenn auch nicht in letzter Konsequenz. Zur Printliteratur in den verschiedenen Gattungen, Bild-Text-Kombinationen wie Bilderbuch und Comics bzw. Graphic Novels, zur performativen Literatur wie dem Theater und zu narrativen Filmen haben wir daher auch die literarischen Hörmedien (Hörbuch, Hörspiel u.a.) hinzugenommen. Bislang noch wenig Beachtung gefunden hat die inter(re)aktive Digitalliteratur. Dabei haben insbesondere Digitale Spiele mittlerweile eine enorme kulturelle Bedeutung im literarischen Kosmos gewonnen, nicht nur für Kinder und Jugendliche. Auch diese Lücke haben wir in der Neuauflage geschlossen.
KI ist in aller Munde und nach neuesten Umfragen verwenden Jugendliche mittlerweile kaum noch Google für ihre Suchanfragen, sondern (kostenfreie) Plattformen wie ChatGPT oder Perplexity. Wie kann zukünftig eine sinnvolle Rolle der KI im Deutschunterricht aussehen, haben Sie dazu Vorschläge?
Matthis Kepser / Ulf Abraham: Die massenhafte Verbreitung von KI-Tools hat viele Lehrkräfte zu Recht verunsichert. Viele Lern- und Prüfungsaufgaben kommen damit auf den Prüfstand, nicht zuletzt solche für den Literaturunterricht. Das betrifft nicht nur (scheinbar) recht formale Schreibroutinen wie die Inhaltsangabe. Auch kreative Aufgaben aus dem Methodenkoffer des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts sind davon betroffen. Innere Monologe beispielsweise formulieren KI-Tools mittlerweile verblüffend gut. Hier ist zunächst die Einsicht zu vermitteln: Wer die Erledigung solcher Aufgaben der KI überlässt, beraubt sich selbst nicht nur der eigenen Lern- und Wachstumschancen, sondern auch des persönlichen Ausdrucksvermögens im Modus kreativer Anschlusshandlungen. Jenseits des KI-gestützten Ghostwritings bieten die Tools aber auch jede Menge sinnvoller Einsatzmöglichkeiten im Literaturunterricht, z.B. als Personal Trainer zur Lösung schriftlicher Aufgaben. KI-generierte Interpretationsvorschläge, schriftliche wie visuelle, können Schüler:innen kritisch reflektieren. Bei der eigenen Suche nach Interpretationszugängen hilft vielleicht ein literarischer Dialog mit einem KI-Chatbot. Automatische Lyrikproduktion lässt über Konzepte von Autorschaft und persönliche Bindung zu literarischen Texten nachdenken. KI-Tools können auch literarische Eigenproduktionen wie das Verfassen einer Kurzgeschichte oder die Hörspiel- und Filmherstellung in vielen Phasen unterstützen.
| Auszug aus: „Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung“ | 14.05.2025 |
| Literaturunterricht Deutsch theoretisch und praktisch | |
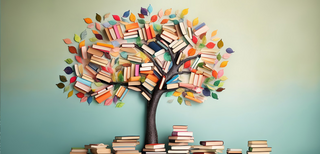 |
Die Fähigkeit, lesen zu können, fördert die kognitive Entwicklung. Sie ist aber auch ein Fenster in andere Welten, Kulturen und Perspektiven. Lesen erweitert den Horizont und wirkt sich vorteilhaft auf den Wortschatzaufbau aus. Der Literaturunterricht ist also ein wertvoller Bestandteil der Schulausbildung. Umso wichtiger ist es, didaktische Voraussetzungen immer wieder zu reflektieren und aktuelle Entwicklungen wie z.B. die Verwendung von Künstlicher Intelligenz, in den Unterricht miteinzubeziehen. mehr... |
Eines der Hauptkapitel in der Einführung trägt den Titel „Konzepte für den Literaturunterricht". Geben Sie den Leserinnen und Lesern damit auch konkrete Praxisvorschläge an die Hand?
Matthis Kepser / Ulf Abraham: Ein fachdidaktisches Einführungswerk, das an dem Anspruch gemessen wird, ein Fach im Ganzen abzudecken, kann die schulische Praxis nur punktuell konkretisieren und muss sich damit begnügen, exemplarisch Beispiele für Unterrichtskonzepte zu verschiedenen Gattungen, Genres und Medien zu nennen. An einzelnen Beispielen diskutieren wir aber das Für und Wider einer Vorgehensweise im Unterricht auch konkret. Besonders haben wir uns um eine ausgewogene Darstellung kontroverser Fragen bemüht, beispielsweise zur Bewertung sogenannter kreativer Arbeiten.
Wir hoffen, auf diese Weise angehenden und praktizierenden Lehrkräften zu mehr Methodenwissen und Problembewusstsein zu verhelfen. Damit sie Antworten auf offene Fragen auch finden, haben wir uns Mühe mit dem erweiterten Index gegeben.
Die erste Auflage Ihrer Einführung erschien vor genau 20 Jahren, im Jahr 2005. Können Sie die zentralen Veränderungen in dieser Zeitspanne benennen? Was ist Ihrer Ansicht nach heutzutage die größte Herausforderung für angehende Deutschlehrerinnen und -lehrer?
Matthis Kepser / Ulf Abraham: Im literaturdidaktischen Diskurs dominiert heute nicht mehr der Methodenstreit (etwa Handlungs- und Produktionsorientierung vs. Analyse), sondern es geht um Themen wie die Mehrdeutigkeit von Texten, die Herausbildung neuer Genres oder die Qualität von Anschlusskommunikation.
Eine der größten Veränderungen im literarischen Handlungsfeld ist seit 2005 aber sicherlich seine enorm gewachsene Mediatisierung. Nicht nur der Deutschunterricht, sondern Schule insgesamt hat sich mit der Outputorientierung und der Konzentration auf messbare Lernerfolge (Kompetenzen) erheblich verändert. Dazu kommt eine in jeder Hinsicht immer heterogenere Schülerschaft.
Fragen der Fachgeschichte, die in den ersten drei Auflagen noch ein hohes Gewicht bekommen haben, stehen zumindest in der Ausbildung junger Deutschlehrkräfte nicht mehr so stark im Fokus. Stattdessen ist eine deutlich höhere bildungswissenschaftliche Perspektivierung festzustellen.
Empirische Forschung trägt einerseits dazu bei, dass unser Wissen um Gelingensbedingungen guten Deutschunterrichts stetig wächst. Auf der anderen Seite müssen aber auch deutschdidaktische Domänen verteidigt werden, die sich der Messbarkeit und exakten empirischen Überprüfung partiell entziehen. Literarische Bildung erschöpft sich nicht im Erkennen bedeutsamer Textstellen, rhetorischer Figuren oder Reimschemata.
Eine der größten Herausforderungen für Berufsanfänger dürften die ständig wachsenden Erwartungen an ein überlastetes, unter Personalmangel leidendes Schulsystem sein. Verantwortlich sind dafür verschiedene Instanzen wie die Bildungspolitik, die Schülerelternschaft und auch der an Bildungsfragen interessierte Journalismus.
Vielen Dank für das Interview!
Sie sind neugierig auf das Buch geworden und wollen mehr über die Vermittlung von Literatur im Unterricht erfahren? Der Titel kann hier bestellt werden.
| Über die Autoren: Prof. Dr. Matthis Kepser, ausgebildeter Gymnasiallehrer mit Unterrichtspraxis, lehrt die Didaktik des Deutschen unter Einschluss der schulbezogenen Medienwissenschaft an der Universität Bremen. Er ist Verfasser und Herausgeber mehrerer fachdidaktischer Publikationen mit dem Schwerpunkt „Medien im Deutschunterricht". Prof. Dr. Ulf Abraham lehrte Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an den Universitäten Würzburg und Bamberg. Seit 2021 ist er Seniorprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist Verfasser mehrerer fachdidaktischer Bücher, u.a. zum literarischen Schreiben, zu Filmen und Bildern und zur Mündlichkeit im Deutschunterricht, außerdem Mitherausgeber der Zeitschrift „Praxis Deutsch". |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik