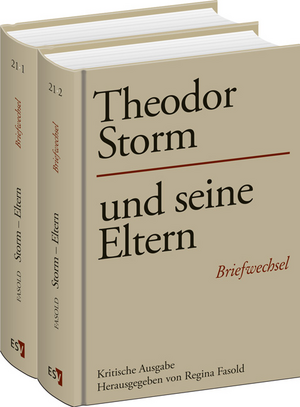„So sind wir denn eifrig beschäftigt, uns in das sonst so ziemlich graue Leben für einen Abend ein Paradies hineinzubauen“
Regina Fasold hat die Korrespondenz zwischen Storm und seinen Eltern aus den Jahren 1852 bis 1864 nun neu editiert und um Texte Constanzes und Lucies erweitert. Der liebevolle und rege Schriftwechsel gewährt einen intimen und sehr privaten Einblick in die weihnachtlichen Traditionen und Turbulenzen der Familie Storm in den Jahren des Exils und den familiären Alltag in festlichen Zeiten, dem wir als Leserinnen und Leser ein wenig beiwohnen können – oder die Familie „darin wandeln und leben sehen“, wie es Storms Mutter einst formulierte (Lucie Storm an Constanze Storm, Husum, Mittwoch, 21. Dezember 1853).
Dass der gegenseitigen Teilhabe am Leben der Familienangehörigen eine bedeutende Rolle zukommt, zeigt sich in vielfältiger Gestalt. Im Jahr 1855, noch in Potsdam, fängt Theodor mit dem Schreiben bereits am 13. Dezember an: „So will ich denn meinen Weihnachtsbrief beginnen, d.h. ich will euch, liebe Eltern mit allerlei gemüthlichen Kleinigkeiten aus unserm täglichen Leben unterhalten, die auch am Weihnachtabend recht lebhaft an uns erinnern mögen!“ Eine Woche lang nimmt er nuancierte Schilderungen der vorweihnachtlichen Umtriebigkeiten im Hause Storm junior vor, um mit den wunderbaren Worten zu schließen: „So sind wir denn eifrig beschäftigt, uns in das sonst so ziemlich graue Leben für einen Abend ein Paradies hineinzubauen, worin nichts sein soll als der Weihnachtsbaum mit seinen Kerzen und seiner kleinen Herrlichkeit, als lächelnde Kindergesichter und stille friedliche Gedanken. Daß es bei Euch so sein möge, dazu, liebe Eltern, hat dieser Brief ein kleines Theilchen beitragen wollen“ (Theodor Storm an Lucie und Johann Casimir Storm, Potsdam, Donnerstag, 13.–Donnerstag, 20. Dezember 1855).
Der Wunsch, den Weihnachtsabend endlich einmal miteinander verbringen zu können, die Sehnsucht nacheinander und der Heimat, bleibt unerfüllt bestehen. So schreibt Constanze schon 1854 an die Schwiegereltern: „Ach würden doch eure glücklichen Gedanken wahr und feierten wir schon den nächsten Weihnachtsabend in Husum, der Tag, wo wir Kind und Kegel wieder auf der Neustadt einzögen würde der glücklichste Tag meines Lebens sein, man lernt das Glück des Familienlebens erst so recht schätzen wenn man es entbehrt“ (Theodor und Constanze Storm an Lucie und Johann Casimir Storm, Potsdam, Sonntag, 17.–Mittwoch, 20. Dezember ‹1854›). Auch für Theodor hängt nicht nur das Glück der Kinder, sondern auch sein eigenes an einem Wiedersehen. „Was gäbe ich dafür, wenn wir nur wenigstens einen Großvater oder eine Großmutter zum Weihnachtabend hier hätten! Ich bin mir an den hier verlebten Weihnachtsabenden immer etwas verwaist vorgekommen; denn wenn überhaupt, so bedarf man an diesem Erinnerungsfeste der Theilnahme und der Vereinigung mit der Familie“ (Theodor Storm an Lucie und Casimir Storm, Heiligenstadt, Mittwoch, 14.–Mittwoch, 21. Dezember 1859). Zu diesem Anlass ruft er Bilder seiner eigenen Kindheit auf, die Weihnachtszeit scheint dabei – nicht nur im metaphorischen Sinne – besonders leuchtend gewesen zu sein. „Wie unendlich gemüthlich war das einst, vor Jahren, zu Haus; wenn in der großen Stube die Lichter angezündet waren, der Theekessel sauste; die braunen Kuchen und Pfeffernüsse standen auf dem Tisch; Vater und wir Kinder warteten dort […], während drüben in der Wohnstube der Weihnachtstisch arrangirt wurde. Ich sehe noch die erleuchtete Außendiele, auf die wir immer, wenn die Hausthür ging, hinausgukten; und mir ist, als habe an diesem Abend die Dielenlampe besonders hell gebrannt“ (Theodor Storm an Johann Casimir und Lucie Storm, Heiligenstadt, Sonntag, 19. Dezember 1858).
Dazu ebenfalls interessieren könnte Sie folgende Meldung:
| Nachgefragt bei Dr. Regina Fasold | 24.08.2023 |
| „Ausgesprochene Erzählbriefe, mit denen Storm den Eltern so lebendig wie möglich den Alltag der Familie in der ‚Fremde‘ und sein Berufs- und Künstlerleben schildern wollte“ | |
 |
Der Briefwechsel Theodor Storms mit seinen Eltern zwischen 1852 und 1864 ist Gegenstand des neuesten Storm-Briefwechselbands. Zusammen mit den noch nie veröffentlichten Briefen von Constanze Storm, die den Schreiben ihres Mannes oft beilagen, und den ebenfalls noch unbekannten Gegenbriefen von Lucie Storm, der Mutter Storms, sowie einigen wenigen Schreiben von Storms Vater Johann Casimir gewähren die Briefe einen tiefen Einblick in ein biografisch wie literarisch bedeutsames Lebensjahrzehnt des Dichters. mehr … |
An eine Rückkehr ist jedoch vorerst nicht zu denken, vor allem, als sich die politische Lage zuspitzt. Wenige Monate vor Beginn des Krieges zwischen Preußen und Österreich gegen Dänemark im Februar 1864 befürchtet Lucie Storm bereits den Zusammenbruch der preußischen Post und verschickt ihre Grüße an den Sohn und dessen schwangere Frau deswegen beizeiten: „Weihnachten steht noch nicht vor der Thür, wol aber die mögliche Unterbrechung des schriftlichen Verkehrs, daher nun unsere Briefe so frühzeitig. Wie es in den Festtagen bei uns aussieht, ob Krieg oder Frieden, ob noch Dänen in unserer Stadt sind, wer weiß, nach den letzten Zeitungsnachrichten muß doch wenigstens ein ruhiges Weihnachtsfest zu erwarten sein. Hoffentlich werdet Ihr dieses Familienfest mit Euren Kindern gesund und froh verleben –, Deine letzten Nachrichten geben uns die Hoffnung, daß auch Constanzens Zustand in der Besserung sei. Wir werden in alter Weise, wenn nicht Krankheit ein Mitglied abhält, was Gott verhüten wolle, unsere Weihnachtskuchen, oder vielmehr Waffeln verzehren, sowie die Karpfen, klein Anna’s Bescheerung mit Thee und Weihnachtsgebäck abwarten und dann sehen was uns der Herr und die Freundlichkeit der Unseren bescheert hat. Viel wird’s nicht werden, die Zeiten mahnen zur Sparsamkeit; immerhin brennen die Lichter auf dem Armleuchter um dem Ganzen ein festliches Ansehn zu geben. Eine Freude würde es werden wenn Deine neue Novelle, lieber Theodor, auf dem Tisch läge. Wir sind nun einmal so verwöhnt, Weihnachten muß ein Geistesprodukt von Dir da sein, so wie auch Briefe von euch – doch wohin verirre ich mich der Krieg kann alle Erwartungen zu Wasser gehen lassen“ (Lucie Storm an Theodor und Constanze Storm, Husum, Montag, 14.–Dienstag, 15. Dezember 1863).
Doch nicht nur der Krieg, sondern auch verschiedenste Unpässlichkeiten und Kinderkrankheiten entpuppen sich als Widrigkeiten, die den Weihnachtsfrieden alljährlich in Gefahr schweben lassen. Ein neues Buch kann der Sohn wiederholt nicht liefern lassen, da er 1860 von Magenkrämpfen geplagt wird, die ihm dem Brief seiner Frau eben nur ein paar wenige Zeilen hinzufügen lassen, nachdem er, „das große Kind“, wie Constanze ihn nennt (Constanze Storm an Lucie Storm, Heiligenstadt, Sonntag, 3. Januar 1858), sich 1857 sogar bei seinen Kindern mit den Masern angesteckt hatte. Der Winter Mitte des 19. Jahrhunderts ist für Erkältungen wie geschaffen, Theodor klagt den Eltern mehrfach: „Unsere Stuben sind so fußkalt; wir sitzen bis an die Kniee wie im Eiskeller. Es fängt nämlich Alles um mich her zu husten an; man ist von unten ganz krystallisiert“ (Theodor Storm an Lucie und Johann Casimir Storm, Heiligenstadt, Mittwoch, 14.–Mittwoch, 21. Dezember 1859), was wiederum Constanzes Erleichterung erklärt, wenn alle wohlauf sind: „Gottlob, daß ich Euch sagen kann, die Kinder sind jetzt gesund“ (Theodor und Constanze Storm an Lucie und Johann Casimir Storm, Potsdam, Sonntag, 17.–Mittwoch, 20. Dezember ‹1854›).
Sie ist diejenige, die ‚den Laden am Laufen hält‘ und sich um das leibliche Wohl aller sorgt. Für die Dekoration allerdings ist im Jahr 1856 noch Theodor höchstselbst zuständig, er sitze, so schreibt er den Eltern, „so zu sagen, schon seit einer halben Woche im Schein des Tannenbaums. Ja, wie ich den Nagel meines Daumens besehe, so ist auch der schon halbwege vergoldet; denn ich arbeite Abends jetzt nur in Schaumgold, Knittergold und bunten Bonbonpapieren“ (Theodor und Constanze Storm an Lucie und Johann Casimir Storm, Heiligenstadt, Samstag, 20.–Mittwoch, 24. und Sonntag, 28. Dezember 1856). Als die Kinder jedoch älter werden, übernimmt Hans das „Netze schneiden und Tannen- und Fichtenäpfel vergolden“ (ebd.), „er wird auch zum ersten Mal dabei mit einer neuen Erfindung debütiren; indem er schon im Herbst zu dem Zwecke gesammelte Eicheln mit vergoldeten Näpfchen in das Tannengrün hängen wird“ (Theodor und Constanze Storm an Johann Casimir und Lucie Storm, Heiligenstadt, Montag, 21. Dezember 1963). Doch nicht in jedem Jahr gelingen die Abläufe reibungslos: „Mit unserem Weihnachten ist es in diesem Jahr ziemlich klötrig bestellt, wir hatten einige Kleinigkeiten bei Rose und Lollo bestellt, bis jetzt ist aber noch nichts passirt; ich habe noch nicht ein mal eine Puppe für Lisbeth, da wird es denn in den letzten Tagen wieder ein Jagen geben, daß man am Weihnachtsabend ganz kaput ist“, gesteht Constanze andernjahrs (Constanze und Theodor Storm an Lucie und Johann Casimir Storm, Heiligenstadt, Donnerstag, 20. Dezember 1860).
Die Kinder jedoch werden immer reich beschenkt, da gibt es für Hans mal eine „kleine Materialwaarenbude“ (Theodor und Constanze Storm an Lucie und Johann Casimir Storm, Potsdam, Sonntag, 17.–Mittwoch, 20. Dezember ‹1854›), mal „ein[en] Apparat zum Pappen, ein Dabiren, ein Spiel was er sich wünscht, 3 Münchner Bilderbogen und ein Buch“ (Theodor und Constanze Storm an Lucie Storm, Heiligenstadt, Freitag, 6.– Freitag, 13. Dezember 1861) und für Ernst ist „eine reizende Jagd von Papirmasché“ (Theodor und Constanze Storm an Lucie und Johann Casimir Storm, Potsdam, Sonntag, 17.–Mittwoch, 20. Dezember ‹1854›), „eine Festung von Pappe zum Zusammenschießen, nebst einer Kanone von Holz, Blei-soldaten, körperlich rund, ein kleines Spiel, Buch und 3 Münchner Bilderbogen“ (Theodor und Constanze Storm an Lucie Storm, Heiligenstadt, Freitag, 6.–Freitag, 13. Dezember 1861) vorgesehen. Die Mädchen bekommen eine „Puppenstube, bunte Stifte eine Wickelpuppe u. etwas Kochgeschirr“ (ebd.). Für Karl hingegen ist das „ausgestopfte[] Kaninchen was ganz täuschend echt ist“ (Theodor und Constanze Storm an Lucie und Johann Casimir Storm, Potsdam, Sonntag, 17.–Mittwoch, 20. Dezember ‹1854›) nicht ausreichend. So freut man sich über die Zuwendungen aus Husum. „Eben liebe Eltern kommen Eure freundlichen Briefe und Geschenke an, tausend Dank für Beides, es kam so recht unerwartet, so bald hatten wir’s noch nicht erwartet, aber doppelt dankenswerth, da können wir es noch für die Kinder anwenden zum Weihnacht. Wir haben im Gedanken auch schon Ueberschlag darüber gemacht“ (ebd.), schreibt Constanze in einem der ersten überlieferten Weihnachtsbriefe. Dass sie als Tochter im Hause Storm aufgenommen wurde, verdeutlicht ein Gedicht ihres Mannes, das er den Geldsendungen und Karten seiner Eltern unter dem Baum beilegt:
„Ein Brief, den meine Mutter schrieb,
Die Dir wie deine eigne lieb,
Nun lies ihn bei den Weihnachtskerzen
Er kommt aus einem goldnen Herzen“ (Theodor und Constanze Storm an Lucie und Johann Casimir Storm, Heiligenstadt, Samstag, 20.–Mittwoch, 24. und Sonntag, 28. Dezember 1856).
So zweifelt Constanze auch nicht an der Liebe, die ihr seitens der Schwiegereltern zuteil wird: „Nun Lebt wohl, meine guten Eltern, grüßt alle Geschwister so herzlich von mir und seid am Weihnachtsabend so froh, so froh wie Ihr in Euren glücklichsten Tagen wart und grüßt mir alle Geschwister so herzlich und die kleinen Kinder. Ich brauche nicht zu sagen denkt an uns, ich weiß Ihr werdet es thun“ (Theodor und Constanze Storm an Lucie und Johann Casimir Storm, Potsdam, Sonntag, 17.–Mittwoch, 20. Dezember ‹1854›).
Falls Sie mehr über das Verhältnis zwischen Theodor Storm und seinen Eltern erfahren möchten, finden Sie hier die vollständige Korrespondenz:
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik