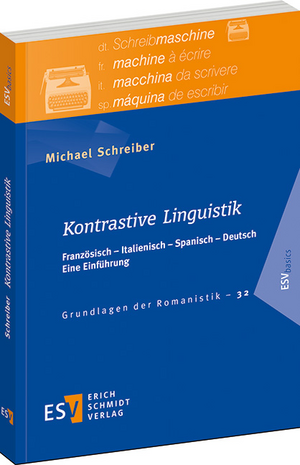„Solide, auf dem Sprachvergleich aufbauende, fremdsprachliche und übersetzerische Kenntnisse nach wie vor unverzichtbar“
Lieber Herr Professor Schreiber, wie ist ihre persönliche Erfahrung mit dem Sprachvergleich als Methode in der universitären Lehre? Wieso sollte sie eine Rolle im Romanistikstudium spielen?
Michael Schreiber: Neben dem praktischen Nutzen (Erweiterung der Sprachkenntnisse und der Fertigkeiten im Übersetzen) hat der Sprachvergleich den Vorzug, Dinge zu verdeutlichen, die bei einer einzelsprachlichen Betrachtung nicht ohne Weiteres auffallen. Um es mit H.-M. Gauger zu sagen: „Wer vergleicht, sieht mehr und anders; es fällt ihm mehr auf, und es fällt ihm mehr ein“.
Sie richten Ihren Band an Studierende, die mindestens eine der Sprachen Französisch, Italienisch und Spanisch studieren und verwenden das Deutsche als zusätzliche Vergleichssprache. Welche neuen Perspektiven kann der Sprachvergleich mit dem Deutschen bieten, auch wenn (oder gerade weil) es sich nicht um eine romanische Sprache handelt?
Michael Schreiber: Die Einbeziehung des Deutschen lag nahe, da sich der Band insbesondere an Leser/innen mit Deutsch als Muttersprache (bzw. Grundsprache) richtet und der Vergleich zwischen Muttersprache und Fremdsprache(n) im Fremdsprachenerwerb hilfreich sein kann. Darüber hinaus werden durch einen Vergleich romanischer Sprachen mit einer nichtromanischen Sprache innerromanische Gemeinsamkeiten besonders deutlich, z.B. im Tempussystem.
An vielen Universitäten ist es heutzutage möglich, eine romanische Sprache zu studieren ohne eine weitere romanische Sprache zu beherrschen. Welche Vorteile hat es Ihrer Meinung nach für Studierende, mit mehreren, insbesondere romanischen, Sprachen kontrastiv arbeiten zu können?
Michael Schreiber: Selbst wenn man (noch) keine aktiven Kenntnisse in einer zweiten romanischen Sprache hat, kann der romanisch-deutsche und innerromanische Sprachvergleich dazu beitragen, erste passive Kenntnisse (Lesekenntnisse) in einer zweiten romanischen Sprache zu erwerben (Stichwort: Interkomprehension).
Der Sprachvergleich spielt eine große Rolle in der Fremdsprachendidaktik. Was macht diese Herangehensweise Ihrer Meinung nach so attraktiv (ggf. auch in Bezug auf Migration/Herkunftssprachen)?
Michael Schreiber: Die Rolle des Sprachvergleichs bzw. die Rolle der Muttersprache in der Fremdsprachendidaktik hat sich im Laufe der Zeit ja immer wieder gewandelt. Ich bin der Ansicht, dass es kontraproduktiv wäre, den Vergleich mit der Muttersprache aus dem Sprachunterricht zu verbannen, denn im Kopf der Lernenden ist die Muttersprache immer präsent. In Bezug auf die Herkunftssprachen könnte der Sprachvergleich sicher noch eine größere Rolle spielen als bisher. Doch dies hängt natürlich auch davon ab, geeignete Lehrkräfte zu finden (und einzustellen).
| Exklusiv für unsere Leser/-innen: Lesen Sie rein in unseren neuen Grundlagenband zur Kontrastiven Linguistik | 12.10.2023 |
| Verstehen durch Vergleichen: Romanische Sprachen im Kontrast | |
 |
Welche Rolle spielt der Sprachvergleich in der Geschichte der Sprachwissenschaft und welche Anwendung findet er in den einzelnen linguistischen Teildisziplinen? mehr … |
Der Sprachvergleich ist in der Sprachwissenschaft eine altbewährte Herangehensweise, gleichwohl, so merken Sie auch in Ihrem Band an, ist sie nicht in allen Teilbereichen gleichermaßen etabliert. In welchen Bereichen der Sprachwissenschaft könnte es Ihrer Meinung nach gewinnbringend sein, der kontrastive Perspektive mehr Raum zu geben?
Michael Schreiber: In Deutschland wird aktuell kaum ein Thema so kontrovers diskutiert wie das „Gendern“. Ein Blick über den deutschen Tellerrand könnte vielleicht dazu dienen, diese Debatte etwas zu versachlichen. Als methodische Basis könnte die Diskurslinguistik dienen, eine relativ junge, stark einzelsprachlich geprägte Disziplin, in der es aus sprachvergleichender Sicht noch viel zu entdecken gibt.
Welche Entwicklungen im Bereich der kontrastiven Linguistik erscheinen Ihnen im Augenblick besonders vielversprechend?
Michael Schreiber: Ich könnte mir vorstellen, dass die Konstruktionsgrammatik noch großes Potenzial für sprachvergleichende Analysen birgt. Da diese Grammatiktheorie an der sprachlichen „Oberfläche“ orientiert ist, könnte sie auch stärker als bisher didaktisch genutzt werden.
Sie beschäftigen sich insbesondere mit der Übersetzungswissenschaft, in der der Sprachvergleich eine große Rolle spielt. Der Beruf des Übersetzers/der Übersetzerin wurde in den vergangenen Jahren aufgrund des immer effektiveren Einsatzes künstlicher Intelligenzen massiv umstrukturiert. Inwiefern kann man durch Sprachvergleich aufzeigen, welche Aspekte der Übersetzung momentan noch schwer zugänglich für solche automatisierten Übersetzungsprogramme sind?
Michael Schreiber: Die neuen Entwicklungen in der so genannten „neuronalen“ maschinellen Übersetzung haben u.a. dazu geführt, dass die sprachliche Qualität maschinell erstellter Übersetzungen deutlich besser geworden ist. Wenn man den Output von Programmen wie DeepL jedoch genauer untersucht, kann man feststellen, dass insbesondere in semantischer und pragmatischer Hinsicht noch viel „Luft nach oben“ ist. Um ein „Postediting“ maschinell übersetzter Texte professionell durchführen zu können, sind solide, auf dem Sprachvergleich aufbauende, fremdsprachliche und übersetzerische Kenntnisse nach wie vor unverzichtbar.
Lieber Herr Professor Schreiber, haben Sie vielen Dank für das Interview!
Wenn Sie neugierig geworden sind, dann können Sie den Band „Kontrastive Linguistik“ aus unserer Reihe „Grundlagen der Romanistik“ ab sofort hier bestellen oder im Buchhandel erwerben: die ideale Lektüre zum Semesterstart.
| Der Autor |
| Michael Schreiber ist Professor für Französische und Italienische Sprach- und Übersetzungswissenschaft an der Universität Mainz. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der sprachenpaarbezogenen Übersetzungswissenschaft, im romanisch-deutschen Sprachvergleich und in der Geschichte der Übersetzung. |
Programmbereich: Romanistik