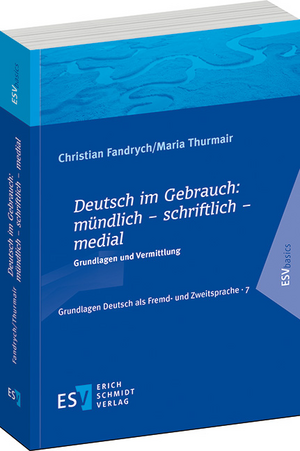Sprache ist nicht gleich Sprache
Wie im ersten Kapitel bereits dargelegt, sind die verschiedenen Formen der Sprachverwendung nicht einfach und klar voneinander abzugrenzen. Wir unterscheiden zunächst zwischen verschiedenen Arten der Versprachlichung (modaler Aspekt): gesprochen – auditiv, geschrieben – visuell (schriftbasiert) und gebärdensprachlich-visuell (auf Gestik, Mimik und anderen körperlich-räumlichen Symbolen basierend). Insbesondere die schriftbasierte Kommunikation kann durch nichtsprachliche Zeichensysteme, wie Bilder und Symbole, weiter angereichert sein. Multimodalität bedeutet dann die Verwendung verschiedener semiotischer Modi in einem kommunikativen Ereignis (vgl. Kress/van Leeuwen 2001: 20, s. auch Spitzmüller 2018). Daneben können verschiedene technische Medien (medialer Aspekt) genutzt werden, um Sprache zu übermitteln, zu speichern oder auch Interaktion auf Plattformen zu ermöglichen (Telefon, digitale Medien, Massenmedien etc.). Unabhängig von der modalen und medialen Realisierung können kommunikative Ereignisse spontan oder geplant, interaktiv oder monologisch sowie flüchtig oder dauerhaft sein.
Die Begrifflichkeiten, die nun für die verschiedenen Verwendungsweisen von Sprache genutzt werden, werden meist nur mit bestimmten Aspekten dieser Vielfalt von Realisierungsweisen assoziiert: „Text“ legt meist eine geplante, medial schriftliche (dauerhaft gespeicherte) und komplexe, monologische Sprachverwendung nahe (etwa Geschäftsbrief, Lexikonartikel, Schulaufsatz), „Gespräch“ ein mündliches, dialogisches und flüchtiges Sprachereignis (z. B. informelles Gespräch am Küchentisch, Diskussionsrunde oder Arzt-Patienten-Dialog). Allerdings finden sich schon in der vordigitalen Welt viele Beispiele von schriftsprachlichen kommunikativen Ereignissen, die dem gerade genannten prototypischen Idealbild nicht entsprechen. So sind etwa Notizzettel, Einträge in Taschenkalender, Schilder im öffentlichen Raum oder Aufschriften auf Produkten von äußerster Kürze geprägt – manchmal bestehen sie nur aus einzelnen Wörtern; sie sind also gerade nicht komplex. Auch sind nicht alle schriftlichen Sprachereignisse notwendigerweise sehr sorgfältig geplant, auf Dauerhaftigkeit angelegt (Einkaufszettel, Post-It-Notiz) oder in sich grammatisch verknüpft (Kassenzettel, Eintrittskarte). Umgekehrt gilt, dass mündliche Sprachereignisse auch vorgeplant und monologisch sein können (persönliche Erzählungen, Zeugenaussagen), teils auf schriftlichen Vorlagen beruhen (Vorträge, Nachrichtensendungen) oder tradierte Inhalte vermitteln (Witzerzählungen, literarische Stoffe, Gebete) – und so ebenfalls auf Dauerhaftigkeit angelegt sein können.
| Nachgefragt bei Prof. Dr. Christian Fandrych und Prof. Dr. Maria Thurmair | 17.06.2025 |
| „Wir müssen wissen, welche sprachliche Optionen wir in verschiedenen Gesprächssituationen haben“ | |
 |
Deutsch lernen kann viele Lernende vor Herausforderungen stellen: Wie verwende ich dieses oder jenes Wort im richtigen Kontext, wie drücke ich mich je nach Gesprächssituation möglichst angemessen aus? Diese und weitere Fragen werden anschaulich im Buch von Christian Fandrych und Maria Thurmaier exemplarisch beantwortet, was es besonders für DaF-Lernende zu einer wertvollen, da praxisnahen Ressource macht. mehr … |
Digitale Kommunikation erfolgt sehr häufig über verschiedene Speichermedien (externe Server, oft auch digitale Endgeräte) und ist so potenziell dauerhaft, auch wenn sie nur dem schnellen Austausch dient (und evtl. schnell wieder gelöscht wird). Alle diese Sprachereignisse können natürlich zudem durch verschiedene technische Medien aufgenommen und so sekundär „verdauert“ werden. Das bedeutet, dass weder modale oder mediale Merkmale noch die Orientierung am Produktcharakter bzw. an (interaktiv angelegten) Prozessen es ermöglichen, einfache und trennscharfe Einteilungen von kommunikativen Ereignissen vorzunehmen. Es ist daher wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass prototypische Vorstellungen, wie sie sich häufig mit „Text“, „Gespräch“ oder „internetbasierter Kommunikation“ verbinden, nicht dazu führen sollten, die Vielfalt an Faktoren und Erscheinungsweisen von Sprachverwendung aus dem Blick zu verlieren (vgl. Fiehler et al. 2004: 99–129). Wenn wir in diesem Buch die genannte Dreiteilung übernehmen, darf dabei nicht aus dem Blick geraten, dass kommunikative Ereignisse in einem mehrdimensionalen Kontinuum angesiedelt und von einer Vielzahl von Faktoren geprägt sind, die jeweils konkret herauszuarbeiten und zu beschreiben sind.
Sie sind neugierig auf das Buch geworden und wollen mehr über den Deutschen Sprachgebrauch erfahren? Der Titel kann hier bestellt werden.
| Über die Autor:innen |
| Maria Thurmair, Professorin für Deutsch als Fremdsprache an der Universität Regensburg; Breite Publikations- und Forschungstätigkeit im Bereich der Linguistik und Sprachvermittlung DaF/DaZ, (Mit-)Autorin an verschiedenen Grammatiken: Textgrammatik (Weinrich), Grammatik für den Bachelor (Habermann/Diewald/Thurmair), Grammatik für DaF/DaZ (Fandrych/Thurmair), Duden-Grammatik (Wöllstein u.a.); Weitere Monographien im Bereich Textsorten, Modalpartikeln, Vergleiche u.a. Christian Fandrych, Professor für Linguistik Deutsch als Fremdsprache am Herder-Institut der Universität Leipzig. Publikations- und Forschungstätigkeit im Bereich Linguistik und Sprachvermittlung DaF / DaZ; Chefredakteur der Zeitschrift „Deutsch als Fremdsprache“, u.a. (Ko-)Autor von Monographien zur Wortbildung, zur Rolle der deutschen Sprache in internationalen Studiengängen (Fandrych/Sedlaczek), zur Textgrammatik (Fandrych/Thurmair), zur Grammatik für DaF/DaZ (Fandrych/Thurmair). Autor verschiedener Übungsbücher (Klipp und Klar Lernergrammatik; Fandrych/Tallowitz; Sage und Schreibe Übungswortschatz, Fandrych/Tallowitz). Mitarbeit an Lehrmateralien. Vortragstätigkeit im In- und Ausland |
Programmbereich: Deutsch als Fremdsprache